Es braucht Quoten, weil sich sonst nichts ändern wird
Gin Müller im Gespräch mit Elisabeth Bernroitner
Im Interview erzählt Gin Müller über die Notwendigkeit von Quoten im Zusammenhang mit einem intersektional gedachten Diverstätsbegriff, Diversity Washing und warum Vernetzung in diesem Feld so wichtig ist.
Bitte erzähle den Leser:innen von dir. In welchem Bereich bist du tätig, wie war dein Weg dorthin und was ist dir wichtig in deiner Arbeit?
Ich arbeite zwischen verschiedenen Bereichen und das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe sehr regelmäßig am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien Lehraufträge und war von 2017-19 Gastprofessor an der Akademie der bildenden Künste Wien (Karenzvertretung für Ashley Scheirl). Schwerpunktmäßig bin ich sehr stark im Bereich von Gender und queeren Thematiken, aber auch im Feld Antirassismus und immer mehr in intersektionalen Bereichen tätig.
Auf der anderen Seite komme ich aus der Theaterpraxis. Ich würde mich sehr stark dem freien Theater zurechnen, wobei meine Anfänge auch im institutionellen Theater, z.B. im Schauspielhaus liegen. Die letzten zehn, fünfzehn Jahre habe ich regelmäßig Produktionen im brut-Koproduktionshaus gemacht, also verstärkt an der Schnittstelle von Theater und Performance gearbeitet. Das dritte Standbein ist immer mal wieder der Aktivismus. Ich war beim Refugee Protest und der Queer Base aktiv, und viel früher gegen die schwarz-blaue Regierung und im noborder-Netzwerk.
Diese drei verschiedenen Bereiche fließen zum Teil ineinander und ergänzen sich. Denn ich sehe mein Theater doch auch als politisches Theater und meine Lehre durchaus als politische Vermittlungsarbeit oder künstlerisch-politische oder aktivistische Vermittlungsarbeit. Bei Aktivismus habe ich oft das Gefühl, dass auch künstlerische Perspektiven oder konzeptionelle dramaturgische Perspektiven eine Rolle spielen oder notwendig sind.
Was hast denn du bisher von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog mitbekommen und wie bist du involviert?
Ich finde super, dass es D/Arts gibt, und war auch beim ersten großen Treffen im zehnten Bezirk im Kulturhaus Brotfabrik. Dort habe ich beim World Café gemeinsam mit Renate Höllwart eine Diskussionsrunde moderiert und fand den Austausch und den Dialog mit den Leuten, die dort waren, sehr interessant. Ich verfolge über Facebook mit, was bei D/Arts passiert, weil ich die Initiative so wichtig finde, und stimme, was Diversität angeht, in vielen Punkten überein.
Du siehst also deine Perspektive und deine Anliegen dort thematisch vertreten?
Ja, absolut.
„Diversität im Kulturbereich heißt, ein gewisses Spektrum auf der Bühne einfach abzubilden”
Was verstehst du selbst unter Diversität? Gibt es Konzepte oder theoretischen Bezüge, die du damit verbindest?
Das Schlagwort Diversity oder Diversität kommt heutzutage bis in die höchsten Ebenen der Politik vor. Es hat absolut schon den Weg in den Mainstream gefunden. Für meine Arbeit bedeutet Diversität, mit einem breiten Spektrum an Menschen unterschiedlicher Hintergründe bzw. Backgrounds zu arbeiten, also intersektional sowohl in Bezug auf Gender und Migration als auch Klassen. Ich sehe den Begriff Diversity sehr stark auf diese Komponenten hin gedacht und natürlich auch mit dem Aspekt der Inklusion verbunden: Was heißt es, Zugänge zu schaffen zu verschiedenen Projekten und auch zur Teilnahme an verschiedenen Projekten? Und ich muss sagen, ich verorte mich dabei sehr stark an der ‚Quotenfront‘ – ich bin sehr für Quoten.
Das ist spannend – diese Thematik wird ja sehr unterschiedlich diskutiert …
Ich kann vor allem für den Theaterbereich sprechen und meine in erster Linie Institutionen, denn der freie Theaterbereich verändert und öffnet sich leichter als der institutionelle Bereich. Dort dauert es immer länger, bis sich etwas bewegt, die Maschine rattert sehr langsam. Um Veränderungen in Gang zu setzen, müssen meistens Maßnahmen von oben implementiert werden. Ich glaube, freie Theatergruppen tun sich da insofern ein bisschen leichter, als sie etwas autonomer agieren können. Es hat zum Beispiel schon eine Zeit gedauert, bis vermehrt Regisseurinnen erschienen sind, weil die Tätigkeit sehr männlich behaftet war. Mittlerweile hat sich das Verhältnis doch sehr geändert, würde ich sagen. Wenn man in die großen Häuser schaut, sind wahrscheinlich noch immer die großen Regie-Positionen, die VIPs oder auch die Intendanzen mehr in Männer- als in Frauenhand.
Aber trotzdem glaube ich, dass sich einiges geändert hat. Auch was Inklusion, Diversität von Migrant:innen betrifft, hat sich schon einiges getan im Theater. Ich glaube aber auch, dass sich ohne Zwang nicht so viel verändert hätte, weshalb ich klar für Quoten bin. Menschen sind zum Teil sehr bequem und es gibt viele Argumente und Ausreden, warum dann doch die andere Person ausgewählt wird. Ich glaube nicht, dass immer nur das Qualitäts-Argument zählen soll, denn Diversität im Kulturbereich heißt, ein gewisses Spektrum auf der Bühne einfach abzubilden.
Deine Erfahrungen stammen aus deiner langjährigen Arbeit im Feld und vermutlich aus der Beobachtung, dass diese Themen schon länger diskutiert werden, sich aber mit dem ausschließlichen Reden – über Machtpositionen und dergleichen – wenig verändert. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Quoten braucht das genaue Hinschauen, wer in unseren zeitgenössischen Kulturinstitutionen, den Theaterhäusern, den Museen fehlt und welche Akteur:innen es braucht. Es stellen sich dabei aber auch Fragen der Identitätspolitiken.
Ich finde die Frage der Identitätspolitiken einen sehr wichtigen Punkt, auch was die Macht der Diversitätspolitik betrifft. Identitätspolitische Diskussionen sind notwendig, können aber auch sehr bestimmend und konfliktreich sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das Einfordern von Diversität zum Teil wieder ein bisschen schwieriger gemacht haben, weil die Leute wieder mehr in ihren „sicheren“ Community-Bubbles bleiben. Eine Gratwanderung.
“Ich habe den Eindruck, dass identitätspolitische Diskussionen zum Teil sehr akademische Diskussionen sind (…).”
Genau. Und Fragen nach Klasse bzw. sozialen Herkünften erhöhen die Komplexität der Diskussion noch weiter.
Ja. Ich habe den Eindruck, dass identitätspolitische Diskussionen zum Teil sehr akademische Diskussionen sind – das sehe ich auch selbstkritisch. In meinen Projekten ist es jedes Mal ein Ringen, zu schauen, wer beteiligt ist und was das heißt. Es fallen einem oft sehr schnell Namen ein, aber es ist notwendig, sich für mehr Diversität zu öffnen und für sich selbst zu überprüfen, wie das Team zusammengesetzt ist. Wie gesagt, ich versuche auf meine eigenen Projekte einen Quotenblick zu richten, weil man sich sehr oft dabei erwischt, in alte Fallen zu tappen. Es ist grundsätzlich nicht schlecht, mit Leuten, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat, wieder zusammenzuarbeiten. Aber es macht den Blick auch enger. Und diesen immer wieder zu öffnen, das ist die Herausforderung. Wenngleich ich selbstkritisch anmerken muss, dass ich selbst diesbezüglich in gewissen Arbeitskontexten immer wieder scheitere …
Meine Projekte sind sehr unterschiedlich und zu verschiedenen Themen und haben zum Teil auch mit verschiedenen Ländern zu tun. Ich habe zum Beispiel viel mit Mexikaner:innen zusammengearbeitet, weil ich sehr lange in Mexiko war. Bei einem Projekt in Zusammenarbeit mit vielen Exil-Iraner:innen hatte ich einen Iran-Fokus, bei einem anderen Projekt mit dem Titel “the que_ring drama project ” habe ich mit ganz vielen verschiedenen Künstler:innen, Studenten:innen, Geflüchteten gearbeitet. Da gab es durchaus auch identitätspolitische – zum Teil auch sehr harte – Diskussionen, die aber notwendig waren. Wir hatten in diesem Projekt ein dramaturgisches Setting geöffnet, in dem die Gruppen auch Autonomie hatten. Wir mussten uns daher damit auseinandersetzen, was genau diese Zusammenarbeit bedeutet und bis zu welchem Zeitpunkt im Erarbeitungsprozess der Performances, Kritik möglich ist und wo ich und wir als Projektleitungsteam eingreifen können. Es haben eben auch nicht alle dasselbe Wissen um Diversität oder Gender-Thematiken oder eben Identitätspolitiken. Ich finde, die Teilhabe an diesen Diskussionen ist notwendig, und bin auch der Meinung, dass diese Inhalte in gewisser Weise aufbereitet werden sollten. Da kommt dann auch oft die Klassenfrage ins Spiel.
„Wer spricht? Wer nimmt sich den Raum? Wer betritt den Raum?”
Aus der Perspektive einer Person, die mit ihren Projekten in Kulturinstitutionen geht und kooperiert: Welche Maßnahmen sind notwendig, um diese Häuser und Institutionen gerechter und diverser werden zu lassen? Wo muss kulturpolitisch Veränderung stattfinden?
Ich glaube, dass es Quoten braucht, weil sich sonst nichts ändern wird. Es hat sich auch in der Genderpolitik gezeigt, dass sich ohne Quoten nichts ändert. Und das trifft auch auf die Diversitätspolitik zu. Ich denke, dass Fokus- und Arbeitsgruppen zu Diversität in Kulturinstitutionen mögliche Wege und Mittel wären, um weitere Perspektiven einzubringen. Wenn es so etwas wie eine verordnete Diversitäts-Quote gäbe, würden vielleicht auch Diversitätsgruppen entstehen, die diese Themen implementieren und diskutieren könnten. Die Mitarbeiter:innen dieser Institutionen müssen natürlich auch mitgenommen werden, denn Diversität kann nicht einfach nur von oben herab implementiert werden. Ein Gesprächsprozess und Schulungsmaßnahmen oder Workshops sind notwendig, um zu erklären, worum es bei dem Thema Diversität geht und welche Gesellschaftskonzepte dahinterstehen. Oft stellen sich in Hinblick auf die Belegschaft Fragen von Solidarität und in Institutionen die Frage von gewachsenen Hierarchien. Theater ist nach wie vor eine der hierarchischsten Institutionen schlechthin. Ich glaube, das hat etwas mit Arbeitskonzepten zu tun. Ich glaube aber nicht, dass sogenannte „flache Hierarchien“ automatisch weniger hierarchisch sind, sondern dass sie oft verdeckt hierarchisch sind. Wichtig ist eine gute Diskussionskultur, Rücksichtnahme und eine immer wiederkehrende Reflektion: Wer spricht? Wer nimmt sich den Raum? Wer betritt den Raum?
„Ich bin der Meinung, dass man den Kunstbegriff immer wieder in Frage stellen muss- und zwar genau an der Schnittstelle von Kunst und Sozialarbeit.“
Wenn wir über die Verantwortungsebene der Häuser selbst hinausblicken, auf die Ebene der Kulturpolitik: Was hältst du von Maßnahmen wie diversitätsorientierten Förderkriterien, also den Nachweis von Fortschritten im Bereich der Diversifizierung als Voraussetzung für Fördergelder? In Deutschland und der Schweiz gibt es Förderprogramme, die Institutionen in ihren Diversifizerungsbemühungen finanziell unterstützen, z.B. durch eine zusätzliche Personalstelle mit Fokus Diversität.
Ich würde das unterstützen, weil alles, was Diversität noch tiefer implementiert, hilfreich ist. Es braucht zuallererst oft eine Analyse bzw. einen Blick von außen bei gleichzeitiger Reflexion nach innen, um zu sehen, wo man schrauben kann und sich öffnen kann, um Veränderung zu initiieren. Was die Kulturpolitik betrifft, braucht es auch einen Blick in Richtung Publikum, weil auch dieses meist nicht sehr divers ist. Gerade wenn man an Theaterhäuser und große Institutionen denkt, sitzt oftmals ein „Silbermeer“ im Zuschauerraum – gutbürgerliche weiße Pensionisten und Pensionistinnen, die sich die Karten leisten können. Auch diese auf der Bühne mit Diversität zu konfrontieren, finde ich sehr gut, ich denke aber trotzdem – und es wird auch schon dran gearbeitet –, dass es eine Publikumsänderung braucht. Da hat es die Musik einfacher als das Theater. Die österreichische und Wiener Kultur des „Bühnendeutsch“, also der „schönen“ deutschen Sprache, habe ich schon vor zehn Jahren für falsch gehalten. Was soll das? Das geht heutzutage nicht mehr. Wir benötigen heutzutage andere Vermittlungskriterien und -ebenen als jemandem das schöne “Bühnendeutsch” beizubringen.
Diskussionen und Aktivitäten, um diversere und breitere Publika zu generieren, werden im Bereich des Audience Development und des Outreach verankert – anstatt einen Inreach, also Veränderungen im Inneren der Institutionen, zu initiieren. Dabei würden diversere Teams auch ein anderes, multiperspektivischeres Programm produzieren, welches andere und neue Publikumsgruppen interessieren würde.
Ich finde, dass Begriffe wie Diversität, aber auch Gender und Class leider zu Labels geworden sind, die „schnell mal draufgepackt“ werden bzw. viel Diversity Washing passiert, weil Diversity heutzutage wichtig ist und überall vorkommen muss. Oft steckt aber extrem wenig dahinter, sowohl auf der Ebene institutioneller Strukturen als auch im Bereich des Publikums. Wobei ich schon sagen würde, dass die Wiener Festwochen eine größere Diversität im Publikum haben als das Burgtheater oder das Theater in der Josefstadt.
Auf jeden Fall, wobei Internationalität nicht dasselbe ist wie Diversität. Die große Frage im Publikumsbereich entzündet sich vor allem am Thema Klassismus.
Das stimmt. Teilweise ist das „diverse“ Publikum in den verschiedenen Einrichtungen ein sehr ähnliches Publikum – oft sind es eher privilegiertere Personen, die den Identitätsdiskurs schon begriffen haben.
“Wenn man wirklich diversitätsorientiert arbeiten möchte, muss man aktiv auf bislang unterrepräsentierte Gruppen und Communitys zugehen.“
Ja, genau. Kennst du – um noch einmal zurückzukommen auf Institutionen und die Kulturpolitik – Good Practices im Bereich von Diversitätsmaßnahmen?
Wenn man wirklich diversitätsorientiert arbeiten möchte, muss man aktiv auf bislang unterrepräsentierte Gruppen und Communitys zugehen. Man kann nicht erwarten, dass sie von selbst kommen. Ich bin auch der Meinung, dass man den Kunstbegriff immer wieder etwas in Frage stellen muss. Und zwar genau an der Schnittstelle von Kunst und Sozialarbeit.
Oft haben diejenigen, die Kunstdiskurse bestimmen, überhaupt keine diversen Hintergründe oder Lebensrealitäten. Ich finde, man muss diese Grenze immer mehr verschieben. Auch Vernetzung finde ich wichtig. Alle kennen sich zwar irgendwie, aber wir agieren immer noch sehr vereinzelt, was, glaube ich, auch etwas mit Konkurrenzdenken zu tun hat. Wien ist ja doch klein …
In welchen Bereichen und auf welche Weise glaubst du, dass D/Arts etwas bewirken und für den Kulturbereich und die Gesellschaft tun kann?
In der Vernetzung sehe ich eine zentrale Aufgabe, und darin, den Diskussionsprozess anzuregen. Die freie Szene reflektiert sich zum Teil relativ viel selbst, aber bis man wirklich in die Institutionen geht oder bei der Kulturpolitik etwas bewirken kann, ist es ein langer Weg. Ich habe oft das Gefühl, dass die Kulturpolitik Labels wie Diversität sehr schnell vereinnahmt und für sich selbst einsetzt. Dann ist „alles divers“ oder wird ein Begriff wie „Cancel Culture“ sehr schnell benutzt. Oft steckt sehr wenig Wissen um diese Begriffe dahinter. Dabei bräuchte es eigentlich einen progressiveren Dialog – es reicht nicht, wenn man sich immer nur ein progressives Schildchen umhängt.
Noch eine Abschlussfrage: Wie nimmst du von Wien aus den Kulturstandort Salzburg wahr und was fällt dir in Bezug auf Diversität im Kulturbetrieb zu Salzburg ein?
Salzburg und Diversität? Dazu fällt mir am ehesten noch die ARGEkultur ein. Ich habe das Gefühl, dass es dort es viele spannende Projekte gibt. Darüber hinaus ist für mich die Stadt Salzburg mit den Festspielen und einem höchstprivilegierten Mäzenatentum verbunden, das sich selbst feiert. Auch wenn der Diversitätsbegriff sicher schon bei den Salzburg Festspielen angelangt ist, treffen sich dort letztlich die abgehobenen oberen Zehntausend. Und im Gegensatz dazu ist die ARGEkultur eine der progressivsten Institutionen, die ich dort kenne.
Gin Müller, Elisabeth Bernroitner ( 2022): Es braucht Quoten, weil sich sonst nichts ändern wird. Gin Müller im Gespräch mit Elisabeth Bernroitner. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 13 , https://www.p-art-icipate.net/es-braucht-quoten/

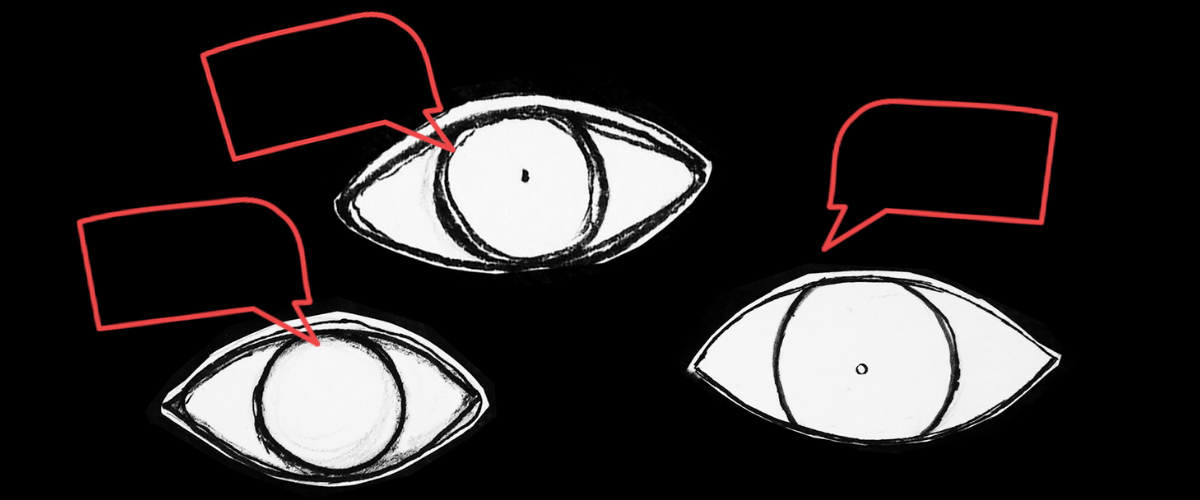





 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis