„Ich sehe meine Arbeit als eine Irritation im Alltag weißer Subjekte.“
Ein Gespräch mit Carla Bobadilla über Kunstvermittlung als anti-diskriminatorische Praxis.
Wir führen dieses Gespräch im Anschluss an einen Workshop, in dem es um die Entwicklung von kritischen Materialien für die Kunst- und Kulturvermittlung ging. Was ist dein subjektives Interesse an der Entwicklung solcher Materialien? Welche Themen, Inhalte oder Motivationen sind für dich ausschlaggebend?
Die Tatsache, dass ich ursprünglich von einer anderen Kultur komme, mit dieser kulturellen Prägung nach Wien gekommen bin und mich als Person in Wien ganz neu erfinden musste, prägt meine künstlerische Praxis und dementsprechend auch meine Kunstvermittlungspraxis. Dieses Neuerfinden war zum Teil sehr schwierig. Wie möchte ich mich in der Öffentlichkeit bewegen? Wie möchte ich gesehen werden? Welche Strategien entwickle ich für mich, um mich in dieser neuen Welt zu positionieren? Gleichzeitig geht es auch darum, wie diese Strategien jetzt nicht nur für mich funktionieren können, sondern auch für andere Personen. Daraus ist diese Praxis entstanden, die nicht rein Kunst und auch nicht nur rein Vermittlung ist. Es ist eine Praxis, die sehr feministisch und auch sehr von postkolonialen und dekolonialen Theorien geprägt ist. Meine Hauptmotivation ist, dass ich die Erfahrungen, die ich als migrantisches Subjekt gehabt und gewonnen habe, an Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, weitergeben kann, sodass ich ihren Weg in irgendeiner Form erleichtern kann. Es hat zwar jede Person einen eigenen Weg, aber trotzdem geht es um die Entwicklung emanzipatorischer Tools zur Selbstermächtigung und zur Anerkennung dessen, was ich als migrantisches Subjekt in dieser Gesellschaft bin.
Du richtest dich also eher an Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du selbst, und nicht so sehr an Menschen, die durch deine Arbeit überhaupt erst mit den Erfahrungen eines migrantischen Subjekts in Kontakt kommen könnten?
Das ist eine sehr interessante Frage. Meine erste Überlegung war, als ich mein Feld von der bildenden Kunst zur Kunstvermittlung gewechselt habe, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, die aus genau so einer Situation wie ich kommen. Das waren die ersten drei, vier Jahre: 2009 bis 2012. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich für diese Arbeit eine ganz andere Ausbildung bräuchte, die ich nicht habe und ich nicht weiß, ob ich mir diese Ausbildung jetzt aneignen will. Die Frage stellte sich wegen der Zeitnot, die ich als Künstlerin in meinem damaligen akademischen Arbeitsfeld hatte. Also habe ich mich gefragt: Was kann ich an dem Ort bewegen, wo ich bin? Wer sind meine Adressat*innen? So bin ich von Subjekten, die genau die gleichen Erlebnisse haben wie ich, zu Mehrheitsangehörigen gewechselt, die zum Teil als Studierende zu mir kommen. Ich unterrichte an der Akademie der bildenden Künste am IKL (Anm.: Institut für das künstlerische Lehramt). Die Studierenden, die zu mir kommen, sind grundsätzlich Mehrheitsangehörige. Der Prozentanteil an migrantischen Menschen ist wirklich sehr niedrig. Da ist eher meine Rolle, Herzen und Köpfe aufzumachen und einen Brechpunkt reinzukriegen. Du hast es heute sehr schön den irritierenden Moment genannt. Davor war meine Idee, meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen für eine Emanzipation oder eine Anerkennung, was migrantische Subjekte sind. Jetzt sehe ich meine Arbeit mehr als eine Irritation im Alltag weißer Subjekte. Was passiert, wenn die Person, die vor mir steht, gebrochenes Deutsch spricht? Was passiert, wenn die Person, die vor mir steht, eine Ausbildung hat, die keine europäische Ausbildung ist? Allein die Tatsache, dass ich vor ihnen stehe, ist ein irritierender Faktor.
Geht es vor einer Gruppe von Mehrheitsangehörigen darum, für Ausschluss und Vielfalt zu sensibilisieren? Sind diese Begriffe für deine Praxis wichtig?
Es sind natürlich wichtige Begriffe, aber es begrenzt sich da. Wie sieht denn Vielfalt in einer Klasse am IKL aus? Was ist da die Vielfalt? Ist die Vielfalt, dass die Leute nicht nur aus Wien kommen, sondern aus den Bundesländern? Dass die Leute aus verschiedenen Bildungshintergründen kommen? Wenn das die Vielfalt ist, dann sehe ich das bei mir in der Klasse sehr klar. Was passiert in einer Klasse, wo du Menschen unterrichtest, die am Land auf dem Bauernhof aufgewachsen sind oder erst in die Hauptschule gegangen sind und dann mit Umwegen die Matura gemacht haben, um nach Wien zu kommen und Kunsterziehung zu lernen? Oder die, die eine Hauptschule besucht haben, dann eine Kindergartenpädagog*innenausbildung gemacht haben, dann die Matura und dann erst ins Lehramt? Meine Lehrveranstaltung ist eine praktische und künstlerische Veranstaltung. Trotzdem arbeiten wir sehr viel mit Texten, das ist mein persönliches, akademisches Begehren ‑ wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich Bücher liebe. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es keine Bücher gab. Die erste Bibliothek hatte ich schon mit 15. Ich habe alles, was ich irgendwie an Geld bekommen habe, in Bücher investiert. Was mache ich damit? Wie produziere ich damit und allein durch die Auswahl an Texten auch Ausschlüsse? Ich habe schon ein Semester hinter mir, wo ich das Gefühl hatte, dass ich das schlecht gemacht habe. Es waren zum Teil sehr komplexe Texte dabei, die für mich selbst sehr schwierig waren. Das ist die Frage für die weiteren Semester und so lange ich da arbeite: Wie schaffe ich Vermittlungssituationen, um mit diesen Texten richtig arbeiten zu können und einen Text mit einer rebellischen Haltung zu lesen? Der schwierige Text ist da und ich verstehe ihn nicht. Warum ist das so schwer geschrieben? Muss ich das unbedingt lesen? Brauche ich ein ganzes Semester dafür? Was mache ich mit diesem Unwohlbefinden? Ich glaube, das ist mir zum Teil schon gelungen.
Also dass die Studierenden auch mit ihren individuellen Voraussetzungen einsteigen können? Wie funktioniert das konkret?
Da merke ich immer, dass ich an meine Grenzen komme, weil ich ja keine pädagogische Ausbildung habe. Ich muss immer im System einer Klasse schauen, wie sich die Menschen verbinden lassen und verbunden bleiben, die aus einer akademischen Familie kommen, mit Menschen, die das nicht haben. Wie schaffen wir, dass nicht nur Lehrende und Lernende voneinander lernen, sondern die Studierenden von sich auch untereinander lernen. Da nehme ich einen Begriff, den ich zum ersten Mal bei einer Aktivistin aus Barcelona gehört habe: Das Konzept der Interdependencia. Unabhängigkeit, oder?
Vielleicht eher: gegenseitige Abhängigkeit, oder einfach Gegenseitigkeit …
… Gegenseitigkeit, genau. Wie funktioniert das zwischen ihnen? Wie helfen sie sich gegenseitig, Sachen zu verstehen?
Wie kann man eine Atmosphäre schaffen, wo das funktioniert?
Wichtig dafür sind für mich gleichzeitig eine bestimmte Empathie und Sensibilität, um zu schauen, wo die Stärke der Schwächeren liegt und diese heraufzuheben. Es gibt Menschen, die funktionieren organisatorisch wahnsinnig gut, oder es gibt Menschen, die komplizierte Zusammenhänge in leichteres Deutsch übersetzen. Dann kann man mit der leichten Übersetzung statt der schwierigen Version arbeiten und dieser leichten Übersetzung eine Wertigkeit geben.
Wie stark versuchst du, durch deine Art zu sprechen, dein Auftreten oder die Gestaltung des Unterrichts, das zu transportieren?
Das ist ein komplizierter Punkt. Es ist nicht leicht. Ich habe eine Arbeitskollegin, die immer einen Arbeitskittel trägt, wenn sie in solchen Lehrsituationen ist. Ich denke, es wäre manchmal viel leichter, wenn ich so etwas haben könnte. Da würde mein Auftreten etwas neutralisierter wirken. Es geht aber nicht nur um das Aussehen oder die Kleidung, sondern auch überhaupt um die Form, wie du sprichst oder du den Unterricht gestaltest. Ich habe mir nach dem ersten Semester an der Akademie jetzt auch überlegt, dass ich innerhalb der Zeit der Lehrveranstaltung Einheiten dafür verwenden möchte, um gemeinsam zu essen. Es gab nämlich sehr komische Situationen, wo zu Beginn der Lehrveranstaltung ein Teil der Studierenden mit Kebab, Sushi und Pizzaschnitte gekommen ist und die andere Hälfte hatte nichts. Dann war eine Pause und die Gruppe, die davor noch nicht gegessen hatte, hat nach der Pause noch gegessen oder sie haben sich versteckt unter dem Tisch etwas geholt und heimlich gegessen. Das ist jetzt nur auf das Essen bezogen, aber das sind Momente, wo du richtig achtgeben musst.
Und wie gehst du auf solche Momente ein?
Wir integrieren es. Wir sagen jetzt von Anfang an, dass wir zwischen zwei und drei essen werden. Machen wir das Essen zu einem Teil der Lehrveranstaltung! Das heißt, wir sprechen über das Essen, was wir gerne essen, wo wir es kaufen, wie viel Zeit wir dafür verwenden. Das sind solche Situationen. Der Raum ist auch wichtig. Für mich ist die Raumsituation sehr wichtig. Wie funktioniert mein Körper in dieser Raumsituation? Diese Lehrveranstaltungen sind ja lang. Ich habe zum Teil vier Stunden hintereinander. Das heißt, ich muss auf den Körper achten. Wann bin ich müde? Wann kann ich nicht mehr? Es muss möglich sein zu sagen, wenn ich eine Pause brauche, wenn wir Luft brauchen, das Licht zu stark ist. Auf solche körperlichen Befindlichkeiten zu achten, ist wichtig. Wenn du in dieser lehrenden Rolle bist, dann vergisst du oft, dass du selbst trinken musst oder selbst eine Pause brauchst. Ich denke, es ist grundsätzlich eine Voraussetzung, auf den Körper zu achten, um überhaupt ein gutes Setting zu schaffen. Ich habe das auch mit den Arbeitsaufgaben gemacht. Ich habe gesagt, dass es eine Abschlussarbeit gibt, die innerhalb der nächsten zwei Monate abgegeben werden muss. Ich habe nicht gesagt, wann, sondern ich wollte, dass die Studierenden mir einen Termin nennen, wann sie gerne abgeben möchten. Dann müssen sie sich aber auch daran halten. Es ist egal, ob sie das am ersten Tag im ersten Monat machen oder am letzten Tag vom zweiten Monat. Aber sie sollen sich daran halten. Es geht darum, diese Freiheit zu geben und gleichzeitig zu sagen, dass sie ihre eigenen Grenzen setzen und dabei verantwortlich bleiben sollen.
„Erwartet bitte von mir nicht, dass es keine Kommunikationsschwierigkeiten geben wird.“
Es geht dir also um Selbstbestimmung in einem gemeinsamen Handlungsraum, ja? Die Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und die Betonung der Selbstverantwortung wären zwei wichtige Aspekte dahin. Ich höre zudem heraus, dass es bei dir viel um die Überlegung geht, wie du verschiedene Menschen zusammenführen kannst.
Ja, und für sie alle ist ein Lernprozess da. Da komme ich selbst von den eigenen Erfahrungen. Es ist nicht nur so, dass ich gebrochenes Deutsch spreche, sondern auch mein Spanisch ist ziemlich gebrochen. Ich vermute, ich bin eine starke Legasthenikerin. Ich habe Schwierigkeiten mit vielen Sachen und es ist so eine Art Handicap. Ich glaube, Menschen mit solchen Handicaps achten darauf, dass andere auch solche Handicaps haben könnten. Dadurch, dass ich selbst an der Volksschule, im Gymnasium und dann an der Universität unter solchen Bedingungen gelitten habe – erstens klassistische Bedingungen, zweitens rassistische Bedingungen, drittens machistische Bedingungen – gibt es für mich keine andere Möglichkeit, als einen Unterricht soweit es geht intersektional zu gestalten. Dass all diese Bedingungen oder all diese Faktoren im Unterricht einen Platz haben. Am Anfang sehe ich in der Klasse nur Mehrheitsangehörige, aber dann reicht ein Unterrichtstag für das Verständnis, wo die Schwierigkeiten da liegen. Aus welchem Bildungshintergrund kommen die Leute? Sind sie in der Stadt aufgewachsen? Sind sie am Land aufgewachsen? Ich fühle mich nicht so, als würde ich das besonders gut können. Ich sehe ständigen Weiterbildungsbedarf.
Du bringst eine hohe Achtsamkeit für Unterschiede oder individuelle Bedingungen zum Ausdruck. Wie förderst du eine solche Achtsamkeit? Du hast vorher gesagt, dass du manchmal sprachlich mit Texten Schwierigkeiten hast. Ist ein offener Umgang mit solchen Schwierigkeiten ein Weg, dass auch andere die eigenen Schwächen zeigen können?
Ja, absolut. Ich sage von Anfang an: Erwartet bitte von mir nicht, dass es keine Kommunikationsschwierigkeiten geben wird. Es wird Kommunikationsschwierigkeiten geben. Deutsch ist meine dritte Sprache. Ich werde mich manchmal so ausdrücken, dass ihr überhaupt nichts davon verstehen werdet. Wir bringen durch unterschiedliche Sozialisierungen auch komplett unterschiedliche Erwartungen mit, wie Sachen gestaltet werden zum Beispiel. Wie schlampig darf mein Unterricht überhaupt sein? Ist das erlaubt?
Ist das etwas, was du auslotest, wie schlampig der Unterricht sein darf?
Ich spreche das schon aus. Ich rede schon offen mit ihnen. Ich finde, da machen sich sehr viele Türen auf. Im Wintersemester nach den Weihnachtsferien waren wir alle da und ich habe gesehen, dass die Gesichter nicht besonders gut waren. Ich habe dann als erste Frage thematisiert, was sie gerade überfordert. Wir gehen ja immer alle davon aus, dass sowohl lehrende als auch lernende Personen in der Lage sind, gut zuzuhören oder zu artikulieren, sobald der Unterricht startet oder einfach prädisponiert zu sein für eine Lernsituation. Manchmal machen sich aber bei dieser Frage so wahnsinnig viele Sachen auf. „Mir geht es wahnsinnig schlecht. Ich habe meine Familie über die Weihnachtsferien getroffen und hatte keine Sekunde Ruhe, wo ich mich auf einen schwierigen Text einlassen kann.“ Wie viel Platz hat so etwas in meinem Unterricht?
Also da ist auch dieser Fokus auf die Bedingungen, die vorhanden sind.
Ja, genau.
Was könnte das produktive Potenzial von Kommunikationsschwierigkeiten sein? Was kann daraus entstehen?
Wenn ein Setting voller Löcher, Kanten und Unebenheiten ist, dann bringt dich das ja in eine aktive Rolle. Plötzlich hast du das Gefühl, dass du etwas machen musst, damit das funktioniert. Es funktioniert wieder einmal als Irritationsfaktor. Sie müssen sich da positionieren und etwas machen, aber es ist für mich immer die Frage, wie selbstverständlich das für die Studierenden ist. Studierende in einem Diplomlehrgang oder auf Masterniveau trauen sich eher und sagen: „Carla, hast du schlecht geschlafen? Soll ich dir einen Kaffee holen?“ Oder sie übernehmen Sachen, die ich selbst nicht kann. In einer Bachelorrunde, wo die Leute zwischen 19 und 23 sind und das die erste Ausbildung ist, die sie haben, sind sie noch nicht wirklich in der Lage, rebellisch dir gegenüber zu agieren.
Aber du hältst es für möglich, dass das Zeigen der eigenen Handicaps oder Schwächen für andere ermächtigend ist?
Ja.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo du das konkret erlebt hast?
Im letzten Semester war ungefähr die Hälfte der Studierenden etwas älter, so zwischen 25 und 30. Sie waren auch sehr erfahren und haben schon andere Lehrveranstaltungen mit ähnlichen Themen besucht, wo sie sich schon einen theoretischen Hintergrund und Tools angeeignet haben. Da hatte ich Tage, wo ich wirklich sehr müde und erschöpft und nicht so schnell im Denken war. Da haben sie schon interveniert und vorgeschlagen, manche Dinge anders zu machen. Ich war in einer so guten Stimmung und so stolz, dass sie eine Intervention gemacht haben. Ich habe gleich gesagt, dass wir das genauso machen und das war für sie irritierend. Sie machten das aus einem rebellischen Impuls heraus und ich habe das nicht als rebellisch, sondern als eine Unterstützung und eine Ergänzung meines Wissens empfunden. Das war für sie ein schwieriger Moment. Am Ende der Lehrveranstaltung hatten wir aber eine Feedbackrunde und da habe ich zu solchen Momenten sehr schöne Kommentare bekommen.
Es ist interessant, dass das funktioniert, wenn du dich durch diese Reaktion der Studierenden nicht in Frage gestellt fühlst. Die Voraussetzung dazu ist wahrscheinlich auch ein Annehmen der eigenen Handicaps, der eigenen Müdigkeit oder was auch immer.
Genau, eine Akzeptanz der eigenen Lage, wie sie ist.
Oder auch einer Wertschätzung diesem Unperfekten gegenüber?
Ja, das absolut. Ich sehe, dass meine Sozialisierung eine starke Prägung ist. Ich komme nicht aus der Hauptstadt Santiago de Chile. Ich komme nicht aus der Mittelklasse Santiago de Chiles, sondern aus der Mittelklasse der Provinz, der Mittelklasse von Valparaíso, einer kleineren Stadt. Valparaíso ist so aufgebaut, dass du, egal zu welcher Klasse du gehörst, immer mit Armut konfrontiert bist. Dein Nachbar ist immer entweder jemand, der viel mehr oder viel weniger Geld hat als du. Damit bist du immer konfrontiert. Und nicht nur das. Du gehst durch deine Tür hinaus und du wirst mit einer Welt konfrontiert, die im Werden ist. Lateinamerika beschreibt sich ja so als der Kontinent, der im Werden ist. Ich glaube, das trifft genau auf diese Situation zu, wo Dinge einfach nicht fertig sind ‑ und so wie sie sind, sind sie gut. Dadurch, dass sie nicht fertig sind, werden andere Prozesse ermöglicht.
Du hast einige Male erwähnt, dass du aus der bildenden Kunst in die Kunstvermittlung gewechselt bist. Lassen sich diese zwei Felder so deutlich trennen? Inwiefern geht es dir auch einfach darum, einen anderen Begriff von Kunst zu prägen, oder inwiefern gibt es vielleicht auch verschiedene Begriffe und du bist von einem zu einem anderen gewechselt?
Ich denke, das liegt sehr stark an der Ausbildung für bildende Kunst. Meine Ausbildung war natürlich eine sehr klassische Ausbildung: Zeichnen lernen, Farben mischen, Materialien für die Bildhauerei, sowohl Holz als auch Metall und Fotografie, klassische Fotografie, Film. All das habe ich durchgemacht. Im Beruf ist dann die Frage, wie das Zeichnen als ein emanzipatorisches Tool dient. Wie kann ich das, was ich in der reinen Kunstausbildung gelernt habe, als emanzipatorisches Tool anwenden? Natürlich gebe ich dir recht. Es ist nicht so, dass ich aufgehört habe, bildende Künstlerin zu sein. Ich verwende alles, was ich als bildende Künstlerin kann und gelernt habe, um solche Prozesse zu ermöglichen. Das Zeichnen ist für mich so ein klassisches Thema. Alle Menschen denken, dass sie überhaupt nicht zeichnen können. „Ich habe das nie gelernt, war immer schlecht und habe immer schlechte Noten bekommen.“ Meine Erfahrung ist, je mehr deine Hand mit deinem Herz verbunden ist, desto besser sind deine Zeichnungen. Wie kann ich das in einem emanzipatorischen Setting von einem Workshop anwenden? Wie kann ich ermöglichen, dass die 15 Leute, die vor mir sitzen, am Ende des Workshops im Glauben sind, dass sie es machen können? Insofern denke ich, weg vom White Cube, aber es bleibt trotzdem noch Kunst.
Marcel Bleuler, Carla Bobadilla ( 2019): „Ich sehe meine Arbeit als eine Irritation im Alltag weißer Subjekte.“. Ein Gespräch mit Carla Bobadilla über Kunstvermittlung als anti-diskriminatorische Praxis.. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 10 , https://www.p-art-icipate.net/ich-sehe-meine-arbeit-als-eine-irritation-im-alltag-weisser-subjekte/

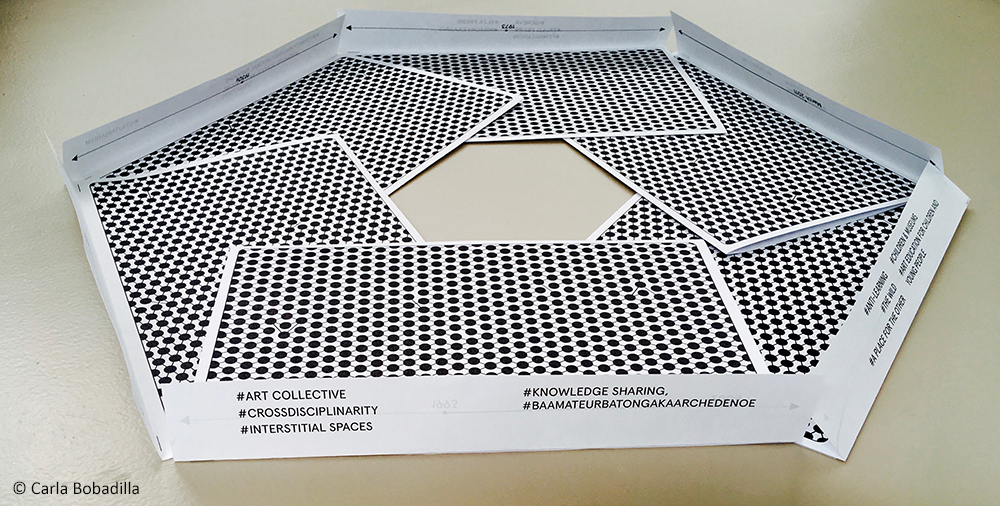
 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis