„Enter now“: Digitalisierung, virtuelle Kunst und Partizipation
David Röthler im Gespräch mit Dilara Akarçeşme
David Röthler ist Experte für Online-Kommunikation und Online-Bildung. Im Interview erzählt er von aktuellen und ehemaligen Projekten und Erfahrungen an der Schnittstelle von Digitalisierung, Kunst, Kultur und Partizipation.
Was bedeutet für dich „Kultur für alle“ und wie setzt du in deinen Projekten kulturelle Teilhabe um?
Kultur für alle erinnert mich an die neuen sozialen Bewegungen der 70er Jahre. Man kann sicher noch andere Bezüge dafür finden, aber Ausgangspunkt dieser Bewegungen war die Studentenbewegung der 68er mit ihren radikaldemokratischen bis hin zu anarchistischen und emanzipatorischen Ansätzen.
Meine aktuellen Projekte sind weniger kultur-, sondern eher bildungsbezogen. Der erste Schritt für Teilhabe ist, Möglichkeiten für Öffnung und Zugänglichkeit zu schaffen. Das passiert hauptsächlich mit digitalen Mitteln. Im Bereich kultureller Bildung wären zum Beispiel Kulturprojekte in Videokonferenzformaten vorstellbar. Der Unterschied ist, dass etwa die Schwelle zum Betreten eines Hörsaals einer Universität möglicherweise eine höhere ist, als auf einen Link zu klicken, zuzuschauen und mitzumachen. Öffnung und Transparenz, hergestellt mit digitalen Möglichkeiten, sind Voraussetzung für Teilhabe oder Partizipation. Es können auch bewährte partizipative Veranstaltungsformate wie Barcamps in den Onlineraum verlagert werden. Selbstverständlich existieren immer Zugangshürden. Nichts kann für alle völlig barrierefrei sein. Man braucht zum Beispiel technische Geräte. Man muss sich trauen. Man braucht gewisse Kompetenzen, um an digitalen Formaten teilzunehmen. Die Hürde der Bindung an einen geographischen Ort fällt allerdings weg. So will ich Teilhabe in digitalen Räumen ermöglichen. Ob dort jetzt Bildung oder Kultur stattfindet, ist dabei eher Nebensache.
Gibt es Personengruppen, die an Projekten – auch wenn sie digital umgesetzt werden – nicht teilnehmen können?
Theoretisch können viele an vielem teilnehmen. Zugangshürden sind oft auch ganz andere als der Ort, das, was Bourdieu als Habitus bezeichnet und beschreibt, zum Beispiel. Wenn ich nicht den entsprechenden Habitus habe, ist das Betreten gewisser Räume wahrscheinlich sehr schwierig, da viel erwartet wird, angefangen von einem gewissen Auftreten bis hin zu einer bestimmten Diskursfähigkeit. Das ist eine große Hürde für Teilhabe.
Kannst du uns über deine Arbeit im Rahmen des Projekts Ankommenstour Querbeet erzählen?
In diesem Projekt haben wir versucht, die Treffen der Ehrenamtlichen in den Salzburger Regionen über Liveübertragungen zugänglich zu machen. Es war tendenziell ein One-to-many-Modell, was bedeutet, dass eine Person zu mehreren gesprochen hat und diese in der Regel in der Rolle der Rezipient_innen geblieben sind. Wenn etwas live ist, dann sollte es natürlich auch die Möglichkeit der Interaktion, beziehungsweise der Beteiligung geben. Das heißt, das gesamte Setting müsste darauf ausgerichtet werden. Bei der Ankommenstour Querbeet war das nicht der Fall. Wenn ein Vortrag live übertragen werden soll, wirkt das langweilig. Es ist zwar schon eine gewisse Art der Partizipation – aber nicht im eigentlichen Sinne. Im Rahmen eines partizipativen Workshops mit Onlineteilnehmenden, in dem etwas entwickelt werden soll, muss gewährleistet sein, dass diesen die gleiche Rolle zukommt wie jenen, die physisch präsent sind. Format und Moderation müssen so gewählt sein, dass alle miteinbezogen werden, auch die, die nicht vor Ort sind. Nur dann sind sie wirklich gleichberechtigt. Das ist allerdings nicht so einfach und man muss hier nach und nach dazulernen.
Kannst du uns ein Beispiel eines gelungenen Versuchs von kultureller Teilhabe aus deiner Praxis nennen?
Wir hatten zum Beispiel ein Projekt zu kultureller Bildung, im Rahmen dessen ein simultaner Besuch von jeweils einer Kirche in Wien und in Köln mit dem gleichen Baustil stattfand. Es gab zwar eine Führung und einen Input, aber gleich im Anschluss daran passierte sehr viel Austausch, der gut funktionierte. Natürlich hatten nicht alle die gleiche Rolle, aber das passiert offline auch nicht. Formate wie dieses bieten jedenfalls das Potenzial, weitergedacht und weiterentwickelt zu werden.
Wie sah die technische Ausstattung dieses Projektes aus?
Die beiden Kulturvermittlerinnen waren jeweils mit einem Smartphone ausgestattet, bewegten sich durch die Bauten und waren live mit einer Reihe von Interessierten verbunden. Diese haben zugeschaut, Fragen gestellt und sind natürlich auch von den Kulturvermittlerinnen gefragt worden, was sie von verschiedenen Dingen halten. Durch diese Fragen wurden die Teilnehmenden, etwa 25 bis 30 Personen, auch ein bisschen geleitet.
Gibt es ähnliche Beispiele aus Salzburg?
Ja, eine Führung fand gleichzeitig in der Galerie 5020 in Salzburg und im Kunsthistorischen Museum in Wien statt. Zwei Kolleginnen führten durch die jeweilige Ausstellung und stellten Fragen an die Teilnehmenden. Ein Künstler nahm daran sogar während einer Autofahrt teil. Gleichzeitig wurde das Ganze auf Facebook gestreamt. Das heißt, man konnte auch über Facebook einsteigen und sich dort beteiligen, was noch einmal eine Öffnung darstellte. Wenn man sich hineinklickte, war man dabei.
Ein anderes Mal hatten wir im Domquartier im Rahmen der Langen Nacht der Museen einen Rundgang per Videokonferenz-App Zoom, wo über die aktuelle Ausstellung gesprochen wurde. Die Hauptproblematik bei solchen Veranstaltungen ist, dass Teilnehmende noch Schwierigkeiten mit dem Format haben. Wenn man sich traditionell mit Medien beschäftigt, ist die eigene Medienerfahrung eher passiv geprägt, wie man es etwa vom Fernsehen kennt. Das Aktivste, was viele Menschen mit Medien tun, ist das Telefonieren oder das Schreiben von E-Mails. Wenn dann eine Kamera aufgebaut wird, denken sie, dass sie erzählen müssen und haben den Eindruck, sie seien nun im Fernsehen oder im Radio. Es ist sehr schwer zu vermitteln, dass das eigentliche Konzept hinter diesen Formaten ein anderes ist, nämlich Interaktion und Partizipation zu ermöglichen.

Museumsrundgang per Videokonferenz-App Zoom
Macht es Sinn, solche Zusammenkünfte aufzuzeichnen und online verfügbar zu machen?
Darüber kann man streiten. Einerseits schafft eine Aufzeichnung Zugänglichkeit und kann Lust machen, teilzunehmen. Andererseits kann sie auch das freie Sprechen hemmen. Ein geschützter Raum kann insofern ein Vorteil für die Teilnehmenden sein, als dass die Hemmschwelle, sich zu beteiligen nicht so hoch ist. In dem genannten Projekt ging es zwar um kulturelle Bildung, aber mit Programmen, wie etwa Zoom, kann auch kulturelle Produktion gemacht werden. Man kann zum Beispiel dazu auffordern, Musik oder Schauspiel zu machen, zu tanzen oder etwas zu lesen. Man kann sogar kollektiv an einer virtuellen Leinwand malen. Es gibt großartige Tools, mit denen man dreidimensional malen kann.
Wie funktionieren diese Tools?
Ich kann etwa auf der Plattform hubs.mozilla einen Raum anlegen, der über VR-Brillen zugänglich ist. Hier steht zum Beispiel „Play with 3D objects” [zeigt auf Laptop]. Wenn ich „Enter now“ klicke, kann ich mit anderen kollektiv malen. Das ist ein 3D-Objekt, das ich kreiert habe [zeigt auf Laptop]. Das kann ich mir nun aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Wenn jetzt noch eine andere Person diesen Raum betreten würde, könnten wir gemeinsam malen oder Objekte gestalten. Das kann ich über die vorhandene Oberfläche schaffen. Wenn ich über die VR-Brille in das Programm einsteige, bin ich wirklich in diesem Setting drinnen und kann dort herumlaufen. Dann kann ich das, was man dort gemeinsam produziert hat, von unterschiedlichen Seiten betrachten und bearbeiten. Das wäre tatsächlich eine Form von künstlerischer Produktion.
Dann gibt es zum Beispiel Google Tilt Brush. Google will im Gegensatz zu Mozilla zwar ein bisschen Geld, dafür sieht es aber auch sehr cool aus. Dort befindet man sich ebenso im 3D-Raum. Das sieht man allerdings nur, wenn man eine VR-Brille aufhat. Mit dieser Brille kann man auch in diese dreidimensionalen Objekte hineingehen und an ihnen arbeiten oder anderen dabei zusehen, wie sie an ihnen arbeiten. Ich muss mich also nicht mehr in einem physischen Raum befinden, um zusammen Objekte zu kreieren. Das ist auch kein Bild mehr, sondern eine Skulptur, an der man kollektiv arbeiten kann.
Click on the button below to load the content of poly.google.com.
Load content
Digitales Malbuch
Oft steht unter den Werken eine Beschreibung, etwa die Lizenz betreffend. Im Hinblick auf Offenheit und Partizipationspotenzial ist es wichtig, dass die Inhalte unter Creative-Commons-Lizenzen stehen. Das heißt, ich kann sie zum Beispiel verwenden und weiterbearbeiten oder in eine eigene Website einbetten. Es ist insgesamt spannender, wenn Inhalte auf diese Weise für alle zugänglich gemacht werden.
Was kannst du zu virtuellen Museumsbesuchen sagen, die so beschaffen sind, dass ein real existierendes Museum an einem anderen Ort durch technisches Equipment simuliert wird?
Grundsätzlich handelt es sich bei dem, was du beschreibst, um keine virtuellen Museumsbesuche. Ein virtuelles Museum wäre eines, das in der physischen Welt gar nicht existiert und nicht eines, das virtuell nachgebaut ist. Tatsächlich virtuell wäre es, wenn die Kunst auch nur im Internet existieren, also nur aus Bits und Bytes bestehen würde und auch nur dort besucht werden könnte. Natürlich kann ein Museum virtuell schön nachgebaut sein. Geht man dann virtuell ins Museum? Das ist eine Frage der Definition. Das kann schon spannend sein, ist allerdings nicht wesentlich interessanter, als wenn Google in Archiven Kunstwerke digitalisiert. Dort kann man sich eben Kunstwerke, die physisch existieren, digital anschauen. Beispielsweise kann man eine Arbeit von Frida Kahlo ganz genau, bis ins kleinste Detail betrachten, weil es die Möglichkeit gibt, sehr weit in sie hinein zu zoomen. So nahe könnte man am physischen Objekt nie sein, digital geht das aber. Das ist jedoch nichts Virtuelles, sondern lediglich eine zeitgemäße Form eines Kunstbildbands. Ein Bildband mit künstlerischen Arbeiten stößt im Hinblick auf die Qualität irgendwo an seine Grenzen. Digital ist die Qualität jedoch signifikant besser. Der digitale Raum eröffnet also durchaus Zugänge zur Kunst, hat aber nicht zwingend etwas mit Partizipation zu tun. Bei den genannten VR-Beispielen hingegen kann ich mir ein Werk nicht nur anschauen, sondern kann auch mitmachen.
Gibt es noch andere Möglichkeitsräume, die VR oder AR öffnen?
Es gibt zum Beispiel Altspace, eine von Microsoft gekaufte VR-Kommunikationsplattform, die tolle Möglichkeiten bietet, sich zu beteiligen. Man trifft sich mit Personen aus aller Welt im virtuellen Raum zu spezifischen Themenblöcken, versteckt hinter Avataren. Man spricht also miteinander, aber man sieht sich nicht wirklich. Man kann gemeinsam Spaß haben, zum Beispiel Trampolin springen gehen, während es völlig in den Hintergrund tritt, wie die Personen in der Realität aussehen. Das heißt, das erleichtert den Zugang, weil man sich nicht sieht, aber trotzdem super miteinander im Raum interagieren kann. Das kann man von jedem Dorf aus machen, und das ist das Besondere, da es nicht in jedem Dorf eine Gruppe mit gleichgesinnten Personen gibt. Beispielsweise findet regelmäßig ein LGBTIQ+ -Treffen statt. Es gibt auch eine „VR-Church Australia and Europe“, in der sich Avatare bewegen und über Gott diskutieren; oder auch Kulturelles, wie etwa Stand-Up-Comedian-Gruppen oder Impro-Theater. In der Beschreibung der Gruppe „Beat Boxing Collaboration“ steht zum Beispiel: „Join our event to add to a collective beat soundscape, where we will design together. Everyone will join the event and will add people to the mix with a microphone after they raise their hand.” Das ist ein großartiges Beispiel von gemeinsamer kultureller Produktion und Spaß. Außerdem ist es kostenlos.
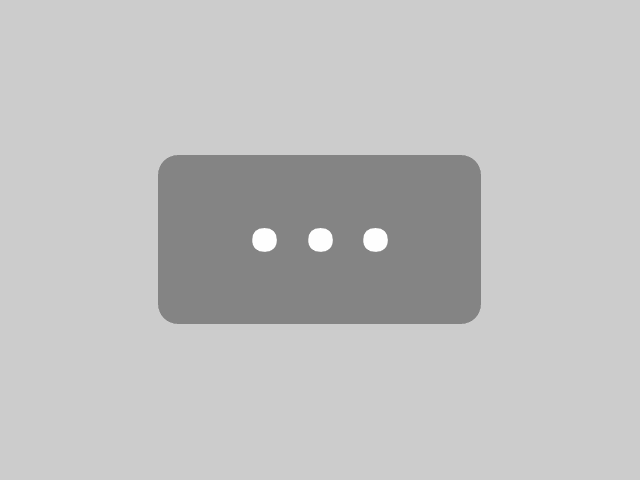
To protect your personal data, your connection to YouTube has been blocked.
Click on Load video to unblock YouTube.
By loading the video you accept the privacy policy of YouTube.
More information about YouTube's privacy policy can be found here Google - Privacy & Terms.
AltspaceVR-Werbevideo
Braucht man dazu unbedingt eine VR-Brille und wie bewegt man sich damit im Raum?
Man kann zwar auch ohne VR-Brille mitmachen, aber die Erfahrung ist deutlich besser, wenn man eine hat. Es ist möglich, sich im Raum zu bewegen, da es Warnungen gibt, falls man Gefahr läuft, irgendwo dagegen zu stoßen. Es sind nämlich Kameras eingebaut, die die Umgebung beobachten, sodass das System genau erkennt, an welcher Stelle man sich im Raum befindet. Somit kann man sich bewegen, mit anderen Avataren interagieren und sprechen. Zum Beispiel vibriert es, wenn man sich die Hand gibt. Das sind Sachen, die man erleben muss, weil das, was ich hier zu beschreiben versuche, sonst sehr abstrakt bleibt.
Gibt es ähnliche Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum?
Deutschsprachiges gibt es noch wenig. Ich habe aber kürzlich eine kleine, aber wachsende deutschsprachige Community für den Bereich Bildung und VR gegründet.
Zentral für unsere Forschungsprojekt sind die Potenziale der Digitalisierung für die Teilhabe marginalisierter Personen. Hast du Erfahrung dazu, welche Zuschauer*innen-Gruppen von digitalen Angeboten profitieren?
Wo der Habitus eine Rolle spielt, schafft Digitalisierung bestimmt neue Zugangsmöglichkeiten. Für Personen, die in das Burgtheater, in die Staatsoper oder zu den Salzburger Festspielen gehen möchten, kann man über digitale Vermittlungsangebote versuchen zu zeigen, wie es dort aussieht, wie es dort zugeht und was man anziehen soll. Solange diese Veranstaltungen im Musikverein, im Festspielhaus etc. stattfinden, bleibt die Schwelle trotzdem sehr hoch. Es bieten aber beispielsweise die Berliner Philharmoniker Konzerte per Livestream oder auch als Aufzeichnung in sehr guter Qualität an. Das kostet dann einfach Geld, was auch wieder eine Hürde darstellt. Ich nehme allerdings an, dass die Personen, die diese Angebote wahrnehmen, ohnehin dem angestammten Publikum angehören und solche Angebote zu Hause zusätzlich in Anspruch nehmen, etwa dann, wenn sie Konzerte nicht physisch besuchen können. Auch werden sie wahrscheinlich von den vielen Fans der Berliner Philharmoniker in Japan wahrgenommen, die natürlich nicht jedes Mal nach Deutschland kommen können. Es wäre jedenfalls interessant zu sehen, ob sich das Publikum der digitalen Philharmonie vom Livepublikum unterscheidet.
Ein weiteres Thema ist das Stadt-Land-Gefälle in Salzburg. Könntest du dir vorstellen, dass Digitalisierung diesem Gefälle entgegenwirken könnte?
Wenn bei Kulturproduktionen oder Beteiligungsprojekten der digitale Raum im Fokus steht, besteht die gleiche Distanz, egal ob am Land oder in der Stadt. Wir hatten einmal überlegt, Atelierbesuche zu veranstalten, um dort interaktive Künstlerinnen- und Künstlergespräche zu führen. Dann macht es keinen Unterschied, wo man sich befindet. Gerade heute hatten wir zum Beispiel eine schöne Workshop-Schaltung mit einer Gruppe in Indien. Unter der Leitung von Elke Zobl wurden gemeinsam mit Studierenden in Mumbai Zines produziert. So können Menschen theoretisch an jedem Ort gemeinsam Theater spielen, ihre Gedichte vorlesen oder Fotos zeigen. Damit ist die geographische Distanz kein Problem mehr. Natürlich bleiben andere Herausforderungen. Einrichtungen müssen wissen, wie die Videoverbindung hergestellt werden kann und müssen sich trauen, das auszuprobieren. Wer von zu Hause teilnimmt, muss einerseits über das technische Equipment verfügen, andererseits benötigt man auch etwas Erfahrung im Umgang damit. Man kann sich aber verschiedenste Maßnahmen überlegen, wie man Hürden reduzieren kann.
Wie schätzt du den Umgang mit dem Thema der Digitalisierung in der Kulturlandschaft Salzburgs allgemein ein?
Die Frage ist, an wen man dabei denkt. Ist das die Kulturverwaltung des Landes, sind es Kulturpolitiker_innen oder Menschen in der Kulturarbeit? Es gibt beispielsweise eine Person in der Kulturabteilung des Landes, die sehr begeistert von diesen Ideen ist und Projekte dieser Art unterstützt hat. Das waren etwa Kulturgespräche aus Kultureinrichtungen im Land Salzburg. Dieses Projekt könnte man auch ganz anders denken, nämlich mehr in Richtung gemeinsames kulturelles Produzieren. Interesse und Bewusstsein sind durchaus vorhanden, aber mit Sicherheit nicht bei allen in der Kulturabteilung, beziehungsweise in der Kulturpolitik. In der Kulturszene selbst gibt es zum Teil sicher auch ein Bewusstsein für diese Art von Konzepten und Ideen.
Die Einschätzung von unserem Forschungsteam ist es, dass dennoch viele Kultureinrichtungen gerade auch in Bezug auf ihren Webauftritt die Barrierefreiheit erhöhen könnten. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass sich mittlerweile auch nicht sehr barrierefreie Webseiten gut mit Spracherkennung, Braille-Zeilen oder anderen Tools auslesen lassen. Das heißt, es gibt Tools, die die Defizite nicht-barrierefreier Webseiten weitgehend ausgleichen können. Zum Beispiel gibt es darunter einige für Bilderkennung, für den Fall, dass vergessen wird, ein Bild zu beschriften. So kann trotzdem erkannt werden, was abgebildet ist. Aber selbstverständlich ist es besser, wenn man das selber eingibt.
Dennoch bedeutet das, dass es größtenteils an den User*innen liegt, sich Skills und technische Tools anzueignen, um Barrieren zu überwinden. Diesbezüglich sind Jugendlichen wohl im Vorteil, da sie mittlerweile Digital Natives sind. Denkst du, dass Kultureinrichtungen darauf zählen können, dass mit ihnen eine neue Generation an digitalen Kultur-Rezipient*innen oder -Teilhaber*innen heranwächst?
Gerade wenn es um kulturelle Produktion oder die Darstellung und Vernetzung des eigenen Lebensraums geht, oder darum, dass Jugendliche über den digitalen Raum erreichbar sind, birgt die Gewandtheit der Digital Natives große Potenziale. Die Jugendlichen werden aber auch nicht zufällig auf die Website des Festspielhauses gehen und schauen, welche Angebote es für sie gibt. Ich glaube, die Jugendlichen, die zum Festspielhaus kommen, sind jene, die über ihre Eltern dorthin kommen. Ein Arbeiterkind wird wahrscheinlich nur schwer von den Salzburger Festspielen erreicht, unabhängig davon, ob sie online sind oder nicht. Daher müssen andere Angebote und andere Arten von Erreichbarkeit geschaffen werden. Das heißt konkret, dass es viel mehr Vermittlungstätigkeit braucht. Die Einrichtungen müssen an die Schulen oder an die Jugendzentren herantreten, oder umgekehrt müssen die Jugendzentren zum Beispiel Exkursionen zu Kultureinrichtungen organisieren. Angebote alleine genügen nicht.
Wenn es darum geht, Jugendliche an etwas heranzuführen, kann das natürlich über das Spielerische oder über Wettbewerbe gut funktionieren. Es gibt ein großartiges Beispiel im Bereich der Musikvermittlung aus Berlin. Das Konzerthaus Berlin hat gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin das sogenannte Virtuelle Quartett und eine App dazu entwickelt, die kostenlos ist und die Möglichkeit bietet, durch VR und AR mit Musik zu experimentieren. Es wurde als Kulturvermittlungsprojekt entworfen, um Musik auf spielerische Art und Weise zugänglicher zu machen. Das ist zwar nicht Gamification im eigentlichen Sinne, aber der spielerische Zugang ist hier sehr zentral.
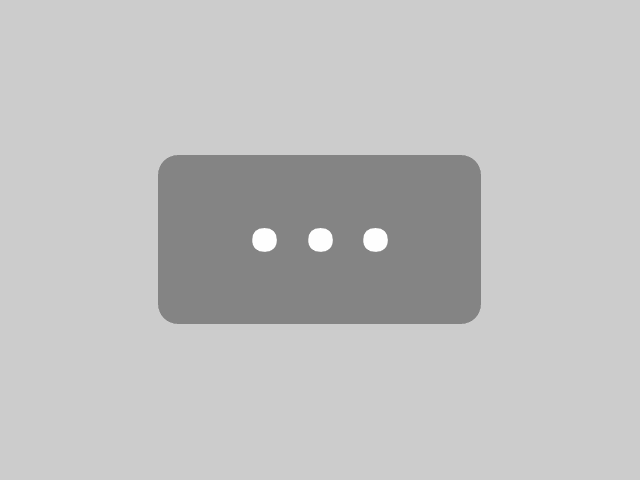
To protect your personal data, your connection to YouTube has been blocked.
Click on Load video to unblock YouTube.
By loading the video you accept the privacy policy of YouTube.
More information about YouTube's privacy policy can be found here Google - Privacy & Terms.
Werbevideo – Das Virtuelle Quarett
Ein weiteres Beispiel, ebenso aus Berlin, ist die Komische Oper. Dort wurden im Publikumsbereich bei allen Stuhllehnen kleine Displays angebracht, auf denen Erklärungen oder Untertitel eingeblendet werden. Neben den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch wird in Anbetracht der großen türkischen Community in Berlin auch Türkisch angeboten
Dilara Akarçeşme, David Röthler ( 2020): „Enter now“: Digitalisierung, virtuelle Kunst und Partizipation. David Röthler im Gespräch mit Dilara Akarçeşme. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 11 , https://www.p-art-icipate.net/enter-now/


 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis