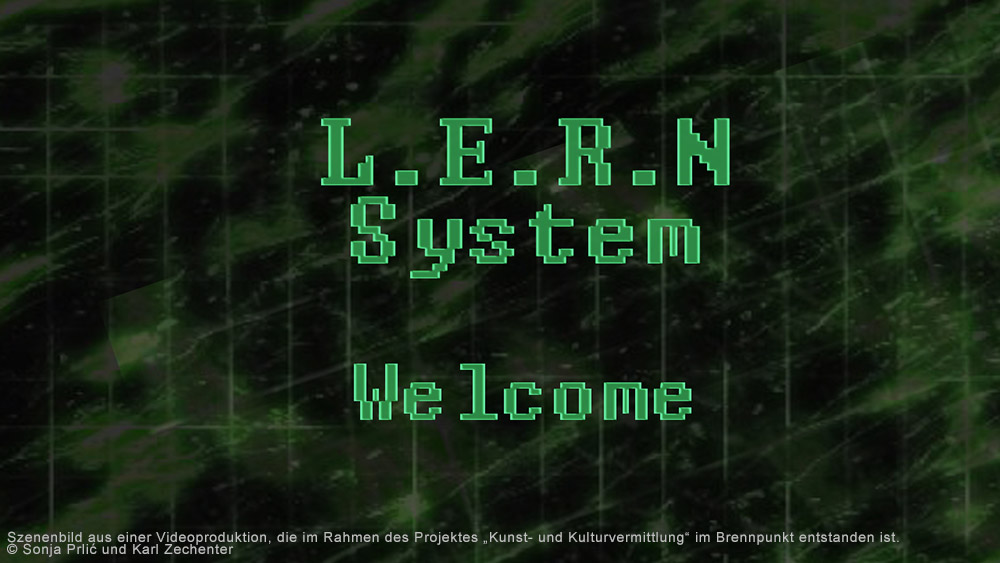Gestaltung als Forschung
Kooperationspotenziale von Design-Based Research und Artistic Research am Beispiel des Projektes Kunst- und Kulturvermittlung im Brennpunkt
Zweite und dritte Durchführungsphase
Ob diese (für DBR-Prozesse charakteristische) Rückkoppelung an die Theoriebildung und die damit einhergehende kritische Reflexion der ersten Phase sich tatsächlich positiv auf die Praxis ausgewirkt hat, ist schwer festzustellen. Faktum ist aber, dass die im Wintersemester 2015/16 (mit einer anderen SchülerInnengruppe und teilweise von anderen KünstlerInnen) abgehaltenen Workshops bedeutend besser verliefen als jene zuvor. Die teilnehmenden Jugendlichen waren beträchtlich motivierter, engagierter und v.a. selbstständiger, den KünstlerInnen machte die Tätigkeit sichtlich mehr Spaß und auch die Endprodukte waren qualitativ um einiges hochwertiger.
Ein wichtiger Grund für diesen Fortschritt bestand in den vorteilhafteren Zugangsweisen der KünstlerInnen in Hinblick auf die zweite Forschungsfrage – jener danach, welche Lehr- und Lernformen sowie Methoden sich als zielführend für ihre Vermittlungsarbeit erweisen. Das hing beim ersten Workshop in diesem Semester damit zusammen, dass er von jenem Künstler geleitet wurde, dessen Computermusikprojekt beim Durchlauf davor scheiterte. Aus der Erfahrung heraus und eventuell auf Basis der Reflexionsgespräche mit dem Projektleiter agierte er diesmal völlig anders. Z.B. führte er seine Klangwerke nicht nur in Form von Ton- und Videobeispielen vor, sondern veranstaltete eine Liveaufführung – und das in einem Schulraum, der sich bedeutend besser als die Klasse dafür eignete. Außerdem regte er die SchülerInnen viel intensiver (und erfolgreicher) zum eigenständigen Entdecken von Klängen und zum Experimentieren damit an. Die beiden LeiterInnen des zweiten Workshops (die im weiteren Verlauf auch intensiv in die konzeptionelle Arbeit eingebunden wurden) setzten noch mehr auf explorative und selbsttätigkeitsorientierte didaktische Verfahren. Sie gaben lediglich eine Grundtechnik vor und animierten die SchülerInnen dazu, sowohl in Hinblick auf die Inhalte als auch die Umsetzung das gesamte Projekt eigenverantwortlich zu gestalten. Einer der entsprechenden Ansätze bestand darin, dass die Jugendlichen in Kleinstgruppen unter Zuhilfenahme der eigenen Smartphones selbstständig Videoaufnahmen in ihrem Stadtteil durchführten, die in das Endprodukt – ein interaktives, mithilfe einer Handy-App erstelltes Computerspiel – integriert wurden. Darin war auch eine Annäherung an die Antwort auf die dritte Forschungsfrage zu erkennen, die darauf abzielte, Möglichkeiten der Erweiterung von Handlungsräumen der Jugendlichen im schulischen Kontext zu erschließen.
In der dritten, mit einer weiteren Klasse durchgeführten Projektphase im Sommersester 2016 war jedoch (wieder) ein Abfall der Motivation und des Engagements der SchülerInnen zu beobachten. Das hatte u.a. damit zu tun, dass diesmal eine Umsetzung mit einer 7. Schulstufe versucht wurde, während die Arbeit bisher mit SchülerInnen der 8. Schulstufe stattfand. Dabei agierten die Jugendlichen bedeutend „kindlicher“, was nicht zuletzt zu einem merklichen Abfall der Motivation und des Engagements der an der Etappe beteiligten KünstlerInnen selbst führte. Als ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten konnte der Mangel an einem Austausch zwischen allen KünstlerInnen, die im Rahmen des Vorhabens bereits Workshops abgehalten hatten, festgestellt werden. Denn die drei WorkshopleiterInnen in diesem Semester hatten (bis auf einen, der bereits in der ersten Phase ein Projekt gestaltete) kaum die Möglichkeit, vorangehende Arbeitsweisen kennen zu lernen. Das machte es ihnen z.B. unmöglich, von den positiven Erfahrungen der KollegInnen aus der zweiten Etappe des Vorhabens zu lernen und verhinderte folglich den Projektfortschritt. Das Problem ist durchaus auf der konzeptionellen Ebene angesiedelt. Denn der Projekteiter war sich von Anfang an der – in der Literatur ausführlich behandelten (vgl. z.B. Mörsch 2005: 17) (*14) – Notwendigkeit eines Austausch aller Beteiligten bei solchen Vorhaben bewusst. Aufgrund von Ressourcenknappheiten, unter denen derartige Unternehmungen meistens leiden (vgl. ebd.), hoffte er aber, mit Kosten verbundene größere Meetings vermeiden zu können. Stattdessen setze er auf – auf seinen eigenen Beobachtungen basierende und mit Projektbeispielen unterstützte – Beratungen der KünstlerInnen. Da der Plan nicht aufging, werden in Zukunft – u.a. mit Hilfe einer Budgetumschichtung – regelmäßige Treffen sämtlicher in das Vorhaben involvierter KünstlerInnen und des Obmanns von subnet sowie des Projektleiters veranstaltet. Das erste davon wurde bereits im Juni 2016 abgehalten. Dabei fand neben dem Erfahrungsaustausch ebenfalls die Besprechung möglicher Verbesserungen hinsichtlich der gesamtkonzeptionellen Ausrichtung statt, womit die KünstlerInnen auch in den Forschungsprozess eingebunden wurden.
(*14) – Notwendigkeit eines Austausch aller Beteiligten bei solchen Vorhaben bewusst. Aufgrund von Ressourcenknappheiten, unter denen derartige Unternehmungen meistens leiden (vgl. ebd.), hoffte er aber, mit Kosten verbundene größere Meetings vermeiden zu können. Stattdessen setze er auf – auf seinen eigenen Beobachtungen basierende und mit Projektbeispielen unterstützte – Beratungen der KünstlerInnen. Da der Plan nicht aufging, werden in Zukunft – u.a. mit Hilfe einer Budgetumschichtung – regelmäßige Treffen sämtlicher in das Vorhaben involvierter KünstlerInnen und des Obmanns von subnet sowie des Projektleiters veranstaltet. Das erste davon wurde bereits im Juni 2016 abgehalten. Dabei fand neben dem Erfahrungsaustausch ebenfalls die Besprechung möglicher Verbesserungen hinsichtlich der gesamtkonzeptionellen Ausrichtung statt, womit die KünstlerInnen auch in den Forschungsprozess eingebunden wurden.

Anderson, Terry/Shattuck, Julie (2012): Design-based research: A decade of progress in educational research? In: Educational Researcher, 41(1), S. 16-25.

Ars Electronica (Hg.). (o.J.): Art-Based Research. Online unter http://stageofparticipation.org/art-based-research (14.7.2016).

Borgdorff, Henk (2009): Die Debatte über Forschung in der Kunst. In: Rey, Anton/Schöbi, Stefan (Hg.): Künstlerische Forschung: Positionen und Perspektiven. Zürich: ZHdK, S. 23-51.

Borgdorff, Henk (2012): The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia. Amsterdam: Leiden University Press.

Cahnmann-Taylor, Melisa/Siegesmund, Richard (Hg.) (2008): Arts-Based Research in Education: Foundations for Practice. New York/London: Routledge.

Design-Based Research Collective (2003): Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. In: Educational Researcher, 32(1), S. 5-8.

Edelson, Daniel C. (2002): Design Research: What We Learn When We Engage in Design. In: The Journal Of The Learning Sciences, 11(1), S. 105-121.

Euler, Dieter (2014): Design-research – a paradigm under development. In: Euler, Dieter/Sloane, Peter F.E. (Hg.) (2014): Design-Based Research. Stuttgart: Franz Steiner, S. 15-44.

Euler, Dieter/Sloane, Peter F.E. (Hg.) (2014): Design-Based Research. Stuttgart: Franz Steiner.

Frayling, Christopher (1994): Research in Art and Design. In: Royal College of Art Research Papers, 1(1), S. 1-5.

FWF – Der Wissenschaftsfonds (Hg.) (2013): Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK). Online unter www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/FWF-Programme/PEEK/ar_PEEK_dokument.pdf (31.8.2016).

KUG – Kunstuniversität Graz (Hg.) (o.J.): Arts-based Research. Online unter www.kug.ac.at/en/arts-science/arts-science/entwicklung-und-erschliessung-der-kuenste.html (30.8.2016).

McKenney, Susan/Reeves, Thomas C. (2013): Systematic Review of Design-Based Research Progress. Is a Little Knowledge a Dangerous Thing? In: Educational Researcher, 42 (2), S. 97-100.

Mörsch, Carmen (2005): Kinder, Lehrende, KünstlerInnen und BegleitforscherInnen machen keine Kunst (wen kümmert´s, wer das, was sie machen, wie bezeichnet) mit Medien – digitalen und analogen (mit was auch sonst). In: Mörsch, Carmen/Lüth, Nanna (Hg.): Kinder machen Kunst mit Medien: Ein/e ArbeitsbDVchD. München: kopead, S. 12-19.

Mörsch, Carmen (2015): Undisziplinierte Forschung. In: Badura, Jens et al. (Hg.): Künstlerische Forschung. Ein Handbuch. Zürich: Diaphanes, S. 77-80.

Pasuchin, Iwan (2015a): Kunst- und Kulturvermittlung im Brennpunkt. Online unter www.w-k.sbg.ac.at/zeitgenoessische-kunst-und-kulturproduktion/forschung/drittmittelprojekte/p-art.html (25.8.2016).

Pasuchin, Iwan (2015b): Kunst- und Kulturvermittlung im Brennpunkt. Ambivalenzen einer (vermeintlich) unprätentiösen Zielsetzung. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten, 6. Online unter https://www.p-art-icipate.net/kunst-und-kulturvermittlung-im-brennpunkt(25.8.2016).

Pasuchin, Iwan (2016): „Diplomatenkinder sind doch keine Ausländer!“ Grenzen des Klassenkampfes vom Klassenzimmer aus am Beispiel des medienpädagogischen Projektes Lehen Style. In Kronberger, Silvia/Kühberger, Christoph/Oberlechner, Manfred (Hg.): Diversitätskategorien in der Lehramtsausbildung. Innsbruck: Studienverlag, S. 136-143.

Peters, Maria/Roviró, Bàrbara (2017): Fachdidaktischer Forschungsverbund FaBiT: Erforschung von Wandel im Fachunterricht mit dem Bremer Modell des Design-Based Research. In: Doff, Sabine/Komoss, Regine (Hg.): Making Change Happen: Wandel im Fachunterricht analysieren und gestalten. Wiesbaden: VS, S. 19-32.

Peters, Sibylle (2013): Das Forschen aller – Ein Vorwort. In: Peters, Sibylle (Hg.): Das Forschen aller. Artistic Research als Wissensproduktion zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft. Bielefeld: transcript, S. 7-21.

Reinmann, Gabi (2005): Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lernforschung. In: Unterrichtswissenschaft, 33(1), 52-69.

Reinmann, Gabi (2014): Welchen Stellenwert hat die Entwicklung im Kontext von Design Research? Wie wird Entwicklung zu einem wissenschaftlichen Akt? In: Euler, Dieter/Sloane, Peter F.E. (Hg.): Design-Based Research. Stuttgart: Franz Steiner, S. 45-61.

Reinmann, Gabi (2015): Reader zum Thema entwicklungsorientierte Bildungsforschung. Online unter http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2013/05/Reader_Entwicklungsforschung_Jan2015.pdf(15.8.2016).

Reinmann, Gabi/Sesink, Werner (2011): Entwicklungsorientierte Bildungsforschung (Diskussionspapier). Online unter http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/11/Sesink-Reinmann_Entwicklungsforschung_v05_20_11_2011.pdf(15.8.2016).

Reinwand-Weiss, Vanessa-Isabelle (2013): Einführung: Forschung in der Kulturellen Bildung. Online unter www.kubi-online.de/artikel/einfuehrung-forschung-kulturellen-bildung (30.8.2016).

Seufert, Sabine (2014): Potenziale von Design Research aus der Perspektive der Innovationsforschung. In: Euler, Dieter/Sloane, Peter F.E. (Hg.): Design-Based Research. Stuttgart: Franz Steiner, S. 79-96.
Nicht zuletzt damit wird argumentiert, dass bei Design-Based Research „trotz allen praktischen Problemlösewillens die Frage der Wissenschaftlichkeit nicht zu kurz“ kommt (Reinmann 2005: 67). Das dient auch als Begründung, warum dieser Zugang „mehr Chancen hat als bisherige Versuche integrativer Ansätze, sich in der wissenschaftlichen Landschaft einen Platz zu erobern“ (ebd.: 66).
Eine detaillierte Analyse aller Ursachen der Probleme kann im vorliegenden Artikel aus Platzgründen nicht vorgenommen werden. Da eine oberflächliche Darstellung der Projektverläufe sowohl den teilnehmenden SchülerInnen als auch den beteiligten KünstlerInnen nicht gerecht werden würde, wird hier darauf fast gänzlich verzichtet. Deswegen erfolgt ebenso lediglich die namentliche Erwähnung jener am Projekt beteiligten KünstlerInnen, die intensiv in die (Weiter-)Entwicklung des Gesamtkonzepts eingebunden waren.
Der Projektleiter ist zwar selbst (auch von der Grundausbildung her) Künstler und hat zahlreiche (medien-) künstlerische Projekte an Schulen durchgeführt. Mit Ansätzen der künstlerischen Forschung kam er aber erst im Verlauf der vorerst letzten Phase des hier beschriebenen Vorhabens in Berührung.
Bisher wurden solche Präsentationen im Bestreben nach der Herstellung eines „geschützten Rahmens“ nicht veranstaltet. Denn bei allen Vorteilen des Arbeitens auf eine Vorführung hin (v.a. in Hinblick auf den Aspekt der Motivation und des Engagements) besteht in Vermittlungskontexten mit „benachteiligten“ Kindern immer auch die Gefahr ihrer öffentlichen Zurschau- bzw. Bloßstellung. Um diesem Problem entgegenzuwirken, fühlen sich die beteiligten KünstlerInnen oft dazu verpflichtet, massiv in die Gestaltung der Endproduktionen einzugreifen, was im Widerspruch zu selbsttätigkeitsorientierten didaktischen Ansätzen steht (vgl. Mörsch 2005: 18). Der Lösungsansatz im vorliegenden Projekt besteht darin, nicht nur die Produkte, sondern auch die dahinter stehenden Prozesse (v.a. jene im Bereich der künstlerischen Forschung) zu präsentieren und mit dem Publikum zu diskutieren.
Iwan Pasuchin ( 2016): Gestaltung als Forschung. Kooperationspotenziale von Design-Based Research und Artistic Research am Beispiel des Projektes Kunst- und Kulturvermittlung im Brennpunkt . In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 07 , https://www.p-art-icipate.net/gestaltung-als-forschung/