Öffentlichkeit als Strategie
Im Vergleich zu Goldegg war die Kassel-Klausur geradezu intransparent – und das fast bis zum Schluss. Selbst das Projektbüro, sonst immer öffentlich, befand sich diesmal hinter verschlossenen Türen. BesucherInnen, die zu uns ins Gemeindezentrum wollten – dort hatte man uns untergebracht –, mussten klingeln oder anrufen, um reinzukommen. Die ersten drei Wochen nutzten wir, um möglichst viele Gespräche zu führen und Informationen zu sammeln. Wer hat welche Bedürfnisse, wer und welche Gremien sind wofür zuständig, wer hat welche Interessen und Machtpositionen? Unsere große Sorge bestand vor allem darin, dass ein ungünstiger Presseartikel alle Bemühungen torpedieren könnte. Schließlich ging es um rund sechzigtausend Euro, die Stadt und Kirche pro Jahr gemeinsam aufwenden müssten. Aus diesem Grund vermieden wir in der ersten Phase jeden Pressekontakt. Nur ja aufpassen, dass nicht zu viel durchsickert – bei über hundert Einzelgesprächen, die wir führten, kaum kontrollierbar. In Gesprächen mit VertreterInnen von Stadt und Kirche Gutwetter machen, aufklären, für Verständnis werben, Sachkenntnis beweisen, leicht euphorisch unter Druck setzen, aber dennoch vorsichtig vorgehen. Dranbleiben. Nach dem Motto – jetzt ist das Eisen heiß, jetzt sind wir da und können als BotInnen, MediatorInnen, KonfliktschlichterInnen, VernetzerInnen fungieren. Aber wie frei kann eine Künstlergruppe agieren, wenn der Gastgeber sich direkten Nutzen verspricht, wenn sich „die Kirche“ eine Verbesserung ihrer Situation erhofft? Wie wird das wahrgenommen? Wie positionieren wir uns? Für wen machen wir das eigentlich? Diese Fragen diskutierten wir intern tagtäglich. „Vielleicht müssen Sie auch nochmal in eine ganz andere Richtung denken“, hieß es bei einem der Treffen mit KirchenvertreterInnen. Aber das kam gar nicht in Frage, die Klausur lief bereits und die Gruppe war auf Kurs. Ausgeschlossen, einen Platz zu finden, mit dem alle einverstanden waren, in sechs Wochen. Und außerdem wollten wir kein Verdrängungsprojekt machen. Letztlich war es so, dass sechs Wochen einfach nicht ausreichten. Und es endete nicht wie geplant mit zwei SozialarbeiterInnen, sondern mit einem rosaroten Gartenhaus. Strategisch auf dem Lutherplatz positioniert, mit dem Ziel, alle relevanten EntscheidungsträgerInnen an einen Tisch zu bekommen, Sichtbarkeit zu demonstrieren und einen fernsehkameratauglichen Eyecatcher zu bieten. Vier Tage lang kleine Gesprächsrunden. Unter vier Augen und ohne Publikum. Hier trafen Leute aufeinander, die mit der Problematik direkt zu tun hatten, inklusive Polizei, die aber noch nie direkt miteinander gesprochen hatten. Das von uns entwickelte Konzept für die Sozialarbeit lag allen Beteiligten vor, worüber sie sprachen, entschieden sie selbst. Nur die finale Entscheidungsträger-Runde wurde moderiert und stand ganz unter dem Zeichen einer Einigung zwischen Stadt und Kirche. Ich weiß nicht, was im Detail ausschlaggebend dafür war, dass sie alle zugesagt haben, sich für jeweils eine Stunde in dieses leuchtende Baumarkt-Ufo zu setzen, das manche PassantInnen schon für Vorboten der documenta hielten, andere für eine Wärmestube. Es war ein Riesen-Aufwand – organisatorisch wie handwerklich. Aber es hat funktioniert. Und alle Beteiligten erlebten nach eigener Auskunft diese Gespräche als Gewinn, wenn auch in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Die Tagespresse wiederum reagierte in gewohnter Weise mit Schlagzeilen. Die Projektkosten von dreißigtausend Euro waren ein kapitaler Aufreger. Das ganze Geld nur für eine Idee? Etwa zeitgleich wurde das Documenta-Ankaufsbudget von sechshunderttausend Euro veröffentlicht … Natürlich ging es nicht nur um eine Idee, sondern deren Realisierung. Aber Kassel ist eben nicht Goldegg. Die Entscheidungswege sind länger unddie Interessenslage ist eine völlig andere. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob man für die Einrichtung von Sozialarbeiterstellen KünstlerInnen braucht und warum man das Geld nicht lieber direkt verwendet. Und erkennen muss man auch, dass das alles Maßnahmen sind, die aufgrund einer bestimmten Politik überhaupt erst notwendig werden.
Ein Jahr nach Beendigung der Klausur jedenfalls, so lang dauerte es schlussendlich, bis Kirche und Stadt sich einig wurden, gibt es sie tatsächlich. Still und heimlich muss das vor sich gegangen sein. In der Presse findet sich nicht mal eine Notiz dazu. Ein Sozialarbeiter-Tandem, Mann und Frau, macht seit Mai 2013 SMS – Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion am Lutherplatz. Sozialarbeit durfte das Ganze offenbar nicht genannt werden. Verankert ist dieses Zuwendungsangebot bei einer Einrichtung der Drogenhilfe Nordhessen. Die Finanzierung ist allerdings derzeit nur bis Ende des Jahres gesichert. Nicht wie gedacht für mindestens zwei Jahre.
Und die Frage, was das mit Kunst zu tun hat, die übergebe ich zum Abschluss an Angela Waldschmidt, Geschäftsführerin der Drogenhilfe Nordhessen. Sie war eine der wichtigsten Beraterinnen und Unterstützerinnen dieses Projektes und kennt auch das Gartenhaus von innen: „Ich hab es als Kunst empfunden, diese Leute zusammenzubringen. Über einen völlig anderen Zugangsweg etwas zu schaffen, was man sonst aufgrund von politischen Barrieren nicht hätte schaffen können.“
Nadja Klement ( 2013): Go Public mit WK.. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 03 , https://www.p-art-icipate.net/go-public-mit-wk/

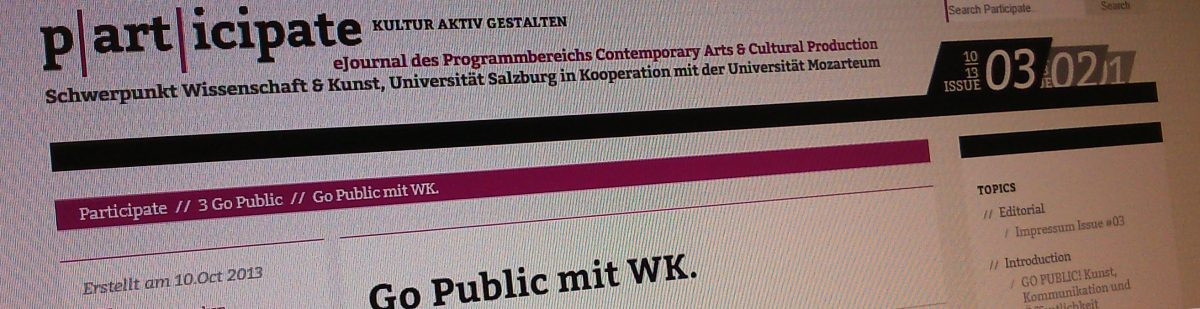
 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis