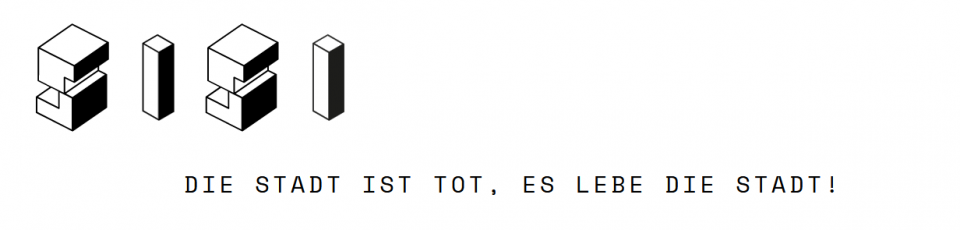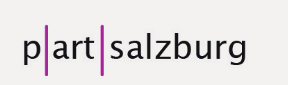Welche Rolle spielt Kommunikation im Projekt SISI? Ihr habt eingangs erklärt, dass das Projekt ein Hybridprojekt ist und sowohl aus einem analogen als auch einem digitalen Raum besteht. Insofern stellt sich mir die Frage der Kommunikation innerhalb des digitalen Raumes. Hat sie in der Umsetzung in Wien stattgefunden? Und wie hat sie stattgefunden?
JPL: Vielleicht spreche ich erstmal über den Ablauf hinter den Kulissen. Ein Projekt von diesem Ausmaß machen ja nicht zwei Leute allein. Da steht ein interdisziplinäres Team, bestehend aus verschiedenen Künstler*innen, Webdesigner*innen, Theoretiker*innen usw. dahinter.
TM: Ein kleines Team. Es wirkt jetzt sehr groß.
JPL: Ja, es waren wechselweise sechs bis acht Personen. Schon in der Zusammenarbeit im Team spielte die Kommunikation eine große Rolle. Wie kommuniziert man so eine Projektidee? Wie kommuniziert man den Ablauf verschiedener Phasen des Projekts intern, im Team? Wie macht man das, wenn sich die Leute an verschiedenen Orten befinden? Kommunikation war in allen Projektphasen enorm wichtig. Ein Kommunikationstool, das wir nutzten, war unsere Website, sisi-project.org. Die Website ist grundsätzlich der Dreh- und Angelpunkt des Projektes, weil SISI eben auch ein digitales Projekt ist. Die Repräsentation im digitalen Raum ist daher zentral. Wir versuchen auf dieser Website klar zu kommunizieren, einfach und für jedermann verständlich. Darüber hinaus versuchen wir mittels visueller Anteile viele Leute anzusprechen und mitzunehmen. Das ist wichtig. Ich habe allerdings grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, komplexe Themen auf Website-taugliche Inhalte herunterzubrechen. Das Beste ist deshalb immer noch, auch vor Ort zu sein, mit den Leuten direkt zu reden und auch im gemeinsamen Tun zu lernen. Deswegen bespielten wir im Rahmen der Vienna Design Week zehn Tage lang einen Leerstand als eine Art Institutszentrale. Wir hatten auch eine Institutseröffnungsfeier, zu der aber niemand gekommen ist, außer Freund*innen. Das Thema war aber Gemeinschaft und man kann Gemeinschaft nicht allein machen. Daher stellte sich uns die Frage, wie wir es schaffen könnten, so zu kommunizieren, dass wir die Leute vor Ort erreichen und mitnehmen.
TM: Als wir vor Ort, in unserer Institutszentrale waren, einem leerstehenden Ladenlokal mit einem großen Fenster, über das wir mit den Leuten kommunizieren wollten, war das schwierig. Wir waren ja nur für kurze Zeit dort – eher wie eine kleine Zecke, die sich zehn Tage lang im Leerstand einnistete und dann auch wieder weg war. Es existiert extrem viel Leerstand, aber ich glaube, die Menschen nehmen das gar nicht so wahr. Sie gingen an uns vorbei. Ich glaube, wir hätten einfach mehr Zeit gebraucht, um dort richtig anzukommen, sodass unser Ladenlokal tatsächlich mit den Bewohner*innen kommuniziert hätte. Wir versuchten natürlich, in einen Dialog zu treten und auf uns aufmerksam zu machen: über Mundpropaganda, über Zettelchen, die wir aufhängten haben oder über das Verteilen von Flyern. Als Teil der Vienna Design Week hatten wir zwar prinzipiell schon eine Plattform, es war für uns allerdings total schwierig, sie gut zu nutzen, weil wir nicht in der Festivalzentrale waren, sondern ganz emanzipiert gesagt haben: „Nein. Wir wollen das nicht. Wir wollen allein und eigenständig sein.“ Wir wollten im Stadtraum sein. Dort haben wir aber gemerkt, dass man Gemeinschaft nicht allein machen kann. Man braucht die Grundlage einer Community, um alles ins Laufen zu bringen.
JPL: Wenn man Community-Arbeit machen will, dann braucht man natürlich eine Community. Es gibt auch nicht nur eine Community in einem Grätzel. Es gibt dort immer viele Communitys und viele Interessen. Dazu kommt, dass ein Werkzeug wie unseres nicht alle bedienen können. Auch haben wir in der Umsetzung gemerkt, dass die Sprache, die wir verwendet haben, sehr auf Inszenierung abzielte und dadurch auch gewisse Schwellen aufgebaut hat. Wir haben also überlegt: „Wie schaffen wir es, in den zehn Tagen dennoch Kontakt zu den Communitys aufzubauen?“ Wir wollten sie quasi von unserer Idee überzeugen oder ihnen unser Tool in die Hand geben, sodass sie es sich eigenständig aneignen und für ihre Zwecke verwenden können.
TM: Es war ein ganz wichtiger Wendepunkt in der ganzen Umsetzung unseres Projektes, als wir wirklich vor Ort waren und mit der Frage konfrontiert waren: „Wir sind jetzt in diesem Stadtraum, aber wie kommen wir an die Leute heran?“ Wir haben uns dann wirklich lokal an einzelne Communitys gewandt, Leute angeschrieben und eingeladen. Auf diese Weise hat sich schließlich doch etwas entwickelt.
Mit wem und in welcher Weise habt ihr die konkrete Umsetzung des Projekts SISI im Rahmen der Vienna Design Week gestaltet?
TM: Es gab einmal das ‚Dahinter‘ und einmal das ‚Davor‘. Hinter den Kulissen gab es uns beide, Jan Phillip und mich, und eine Grafikdesignerin, die die digitale Kommunikation und auch viel Print gemacht hat. Dann war ein Politikwissenschaftler mit an Bord, der sich zum Beispiel mit dem Thema des ‚Nudging‘ beschäftigt hat. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, inwiefern mich der Stadtraum, oder die Gestaltung des Stadtraums in meinen Entscheidungen beeinflussen kann. Darüber hinaus haben wir mit Leuten aus dem Bereich der Szenografie und der Bühne gearbeitet, die – wie ich auch – eher in Richtung performativen Urbanismus arbeiten. Auch aus dem Feld der Psychologie hatten wir Mitarbeitende. Besonders wichtig waren für dieses Projekt aber auch jene Menschen, die – sozusagen in der Umsetzung – von außen kommen. Einige Menschen sind ganz interessiert in das Ladenlokal gekommen und haben dort Informationen eingeholt. Andere Personen aus dem internen Bereich haben wir direkt angeworben. Das waren Freund*innen oder Bekannte, die wir zu Spaziergängen eingeladen haben. Dann gab es die Communitys, die wir versucht haben, mit ins Boot zu holen, zum Beispiel die Grünen aus dem 9. Bezirk. Über sie konnten wir unser Ladenlokal kostenlos nutzen. Das Problem lag aber darin, dass wir uns ursprünglich keiner Partei zuwenden wollten. Dann war es aber so, dass wir mit Momo Kreutz zusammengekommen sind, der Bezirksvorsteherin der Grünen im 9. Bezirk. Das war letztlich schon sehr bereichernd, weil sie uns mit der Gruppe der Lokalen Agenda und anderen lokalen Schlüsselfiguren in Kontakt bringen konnte. Das war für uns und das Projekt enorm wichtig.
JPL: Im Idealfall sind Partizipationsprozesse für mich dann erfolgreich, wenn wirklich alle, die interessiert sind, gemeinsam Dinge entwickeln, erarbeiten und weitergeben können. Das braucht allerdings viel Arbeit und viel Zeit. Es muss einem auch bewusst sein, dass man scheinbar immer, wenn man etwas Digitales macht, bestimmte Menschengruppen von Anfang an ausschließt, weil bei bestimmten Personengruppen die Schwellen im Umgang mit digitalen Medien sehr hoch sind. Das ist auch der Grund, warum es immer Sinn macht, digitale Aktionen und Projekte auch mit einer analogen Komponente zu verbinden.