Über Körper, kulturelle Normierung und die Anforderung einer „Kultur für alle“ im Kontext von Dis_ability
IV. Neue Denkansätze auf dem Weg zur Inklusion in eine vielfältige Gesellschaft
Inklusion ist das ganze Leben
Weil Kultur als Lebenspraxis verstanden wird, betrifft dies auch Inklusion; Inklusion in das gesamte Leben (vgl. Hoffmann 1981: 32). (*5)
(*5)
Wenn über Inklusion gesprochen wird, dann meistens in Kontexten wie Bildung oder Arbeit; im Vergleich dazu nur selten zu anderen Themen. Inklusion ist aber das gesamte Leben. Sie ist unteilbar. Ein Miteinander aller Menschen lässt sich nicht auf einen Arbeitsplatz oder die Schule beschränken. Freund_innenschaften, Beziehungen, Freizeit oder Wohnen sind genauso wichtig und benötigen ebenso viel Persönliche Assistenz, also individuelle Unterstützungsformen.
„Entscheidend [für Inklusion] ist, dass nicht ‚Normalität‘ die Leitkategorie ist, an der sich alle orientieren müssen, sondern die Anerkennung menschlicher Vielfalt. Erst wenn es gelingt, ein solches Klima – in Verbindung mit Barrierefreiheit von Gebäuden und Lehrmethoden – zu schaffen, kann eine neue Qualität im Umgang zwischen Menschen unterschiedlicher Befähigung, unterschiedlichen Geschlechts, sozialer und ethnischer Herkunft etc. erreicht werden und tatsächlich von Inklusion gesprochen werden.“ (Köbsell 2012: 52) (*9)
(*9)
Daran kann deutlich gesehen werden, dass es im Kern der Sache nicht um Aufträge und Verpflichtungen durch die UN-Konvention über die Rechte behinderter* Menschen geht, und darum Vereinbarungen zu unterzeichnen, Gebäude umzubauen oder Fortbildungen anzubieten – sondern auf die Haltung kommt es an! Es geht also um sehr viel mehr: nämlich um ein Lebenskonzept! (vgl. Löhrmann 2015: 296). (*24)
(*24)
Der eigentliche Bedeutungsgehalt dieser Aussage wird durch das Motto der „behindert und verrückt feiern“-Parade in Berlin von 2017 deutlich: „ganzhaben statt teilhaben“. Nicht nur ein Tortenstück abbekommen, sondern an der ganze Torte teilhaben.
Um eine Inklusion ins ganze Leben zu erreichen, braucht es Begegnungsorte für ALLE Menschen, um Gleichheit und Respekt zwischen Menschen – mit allen Geschlechtern und Sexualitäten, mit allen Körpern und Abilities („Fähigkeiten“), jeden Alters, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion etc. – zu fördern. Dadurch können Vorurteile, vorgefasste Meinungen und Barrieren in der Begegnung abgebaut werden. Dementsprechende Rahmenangebote einer authentischen Begegnung führen zu einer Gesellschaft, die Vielfalt, Verschiedenheit und Individualität gewohnt ist und zu schätzen weiß. Dies bezieht sich auf alle Kultur- und medialen Angebote (vgl. Magdlener 2015: 192; (*12) s.a. Hoffmann 1981: 283 f.;
(*12) s.a. Hoffmann 1981: 283 f.; (*5) Rosner, vormals Rebl 2008: 54 f.).
(*5) Rosner, vormals Rebl 2008: 54 f.). (*15)
(*15)
Auf den Punkt gebracht, geht es also um ein Miteinander und um Fürsorglichkeit in einem politischen Sinne; ein Sich-umeinander-kümmern, Sich-Unterstützen und Füreinander-Einsetzen. Im Endeffekt geht es um eine Koalition zwischen unterschiedlich privilegierten Personengruppen. Es geht dabei nicht um programmatische Solidarität, sondern um das Aufbauen von ehrlichen, authentischen Beziehungen in einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung. Ist es nicht eigentlich das, was mit Inklusion gemeint ist?!*8 *(8)
Elisabeth Magdlener ( 2018): Über Körper, kulturelle Normierung und die Anforderung einer „Kultur für alle“ im Kontext von Dis_ability. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 09 , https://www.p-art-icipate.net/ueber-koerper-kulturelle-normierung-und-die-anforderung-einer-kultur-fuer-alle-im-kontext-von-dis_ability/

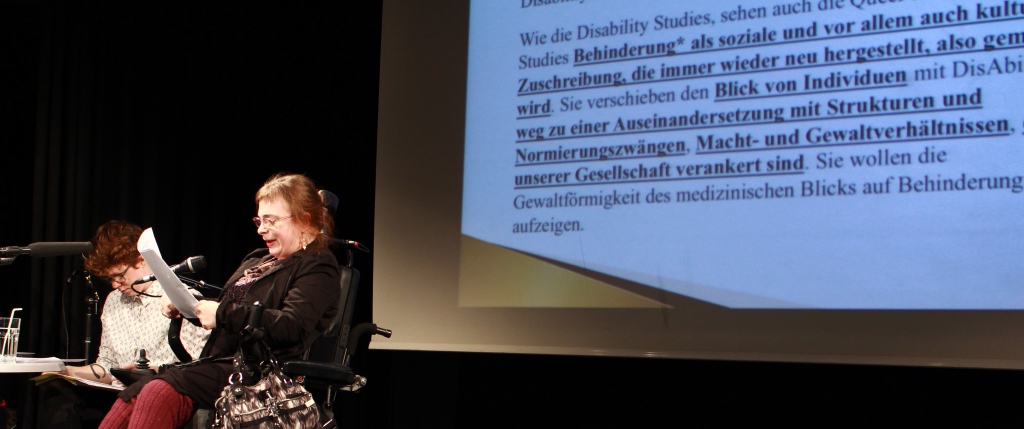

 Artikel drucken
Artikel drucken