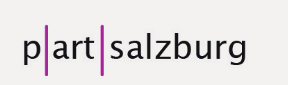Sie haben es bereits angedeutet, ich würde hier gerne trotzdem explizit noch einmal nachfragen: Gab es auch Ideen, die nicht von Studierenden in Lehrveranstaltungen bzw. vom Projektteam entwickelt und angestoßen, sondern von außen herangetragen und umgesetzt wurden?
Auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel die Mobilitätsschule. Der Gedanke dahinter ist, dass Jugendlichen schon im Fahrschulalter auch andere Mobilitätsarten vermittelt werden als nur der Führerschein fürs Auto oder Motorrad. Diese Idee wurde von einer zivilgesellschaftlichen Akteurin, einer ehemaligen Fahrschullehrerin, bereits ganz zu Beginn ins Reallabor getragen, wurde aufgegriffen, weiterentwickelt und existiert nach wie vor. Ebenso die Plusrad App, für die sich ein Akteur im Rahmen des Reallabors eingesetzt hat. Aber gerade bei solch großen Projekten stellt sich für jemanden, der eigentlich hauptberuflich einen anderen Job hat, früher oder später immer die Frage „Wie viel kann ich einbringen? Und ab wann will ich Ideen vielleicht auch nicht mehr kostenlos mit allen teilen?“
Das verstehe ich sehr gut. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich fragt „Soll ich das weiterhin alles mehr oder weniger unentgeltlich machen?“ Und oft geht es wahrscheinlich gar nicht in erster Linie darum, aber ohne gute Einbettung etwas voranzutreiben, das überschreitet die Ressourcen irgendwann … Da braucht es wohl auch viel Gespür seitens des Projektteams.
So ist es. In der zweiten Förderphase zum Beispiel machten wir einen Workshop, zu dem wir Studierende und Zivilgesellschaft einluden. In dieser Konstellation wurden gemeinsam Ideen diskutiert und entwickelt; es bildeten sich in diesen Prozessen automatisch Teams, die auch gemischt waren. Dann gründeten wir eine Jury, bestehend aus uns Initiator*innen, aber auch aus Menschen aus Stadtverwaltung, Uni, Kunst, Kultur und Theater. Es wurden drei Projekte ausgewählt, wobei ein Projektteam nur aus Studierenden bestand, die beiden anderen waren gemischt. Da waren also schon Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft dabei, die sich allerdings entsprechend weniger eingebracht haben als die Studierenden, die dafür ihre ECTS-Punkte erhielten und dementsprechend darauf achteten, ihr Projekt auch zu Ende zu bringen oder weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit funktionierte gut. Für uns war das Involviert-Sein der Studierenden daher immer schon so ein bisschen die Garantie, dass sich die Projekte auch wirklich weiterentwickelten. Dazu kann man ja niemanden zwingen ‑ und das will man ja auch nicht.
Wie würden Sie die Rolle beschreiben, die Sie als an der Universität beschäftigte Wissenschaftler*innen eingenommen haben? Neben der Koordination war Ihre Aufgabe ja auch die wissenschaftliche Begleitung. Wie kann man sich diese vorstellen?
Mein persönlicher Aufgabenbereich war, wie gesagt, ein Stück die Koordination innerhalb der Institute. Darüber hinaus entwickelten wir am Städtebau-Institut Lehrformate, um die Studierenden einzuladen, Teil des Projekts zu werden. Dann entwickelten wir noch verschiedene Workshops. Wir unterstützten die Studierenden bei der Ausarbeitung ihrer Ideen, aber auch bei deren Umsetzung. Wir waren also von der Metaebene der Idee, in welche Richtung das Projekt gehen soll, bis hin zur Eins-zu-Eins-Umsetzung dabei. Dass mein Kollege und ich zufällig auch Schreiner sind und deshalb auch wirklich bei der Umsetzung vor Ort noch helfen konnten, war von Vorteil. Aber diese vielen Tätigkeiten waren schon immer wieder auch eine Herausforderung: der Austausch mit der Stadtverwaltung, das Einholen von Genehmigungen, Versicherungsfragen und daneben aber auch die Umsetzung und die wissenschaftliche Begleitung. Die Fragen: Wo wollen wir hin? Welche Frage stellen wir hier eigentlich gerade an die Stadt und an das Experiment? Das war schon viel. In der wissenschaftlichen Begleitung hatten wir aber zum Glück Unterstützung aus der Sozialwissenschaft. Die Experimente zu evaluieren und auszuwerten war dann beispielsweise nicht meine Aufgabe.