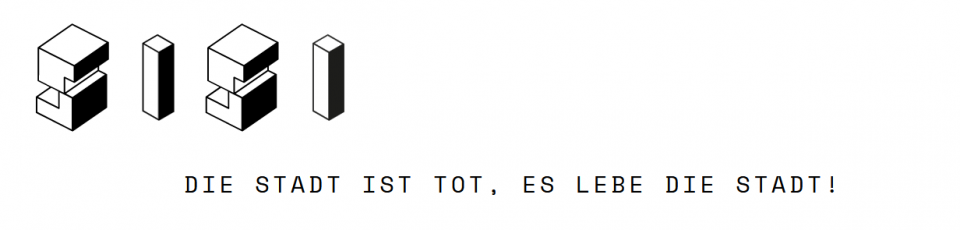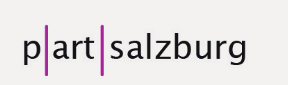Welche Räume sind für das Projekt SISI entstanden?
JPL: So einige Räume sind entstanden. Das Thema war, wie bereits angesprochen, Gemeinschaft, und wir haben nach neuen Räumen der Gemeinschaft gesucht. Wir haben bewusst von neuen Räumen gesprochen, denn es gibt ja in jeder Stadt immer schon gewisse Orte, die allgemein als Gemeinschaftsräume verstanden werden: öffentliche Plätze, Parks, mittlerweile vielleicht sogar Einkaufszentren. Uns interessierte daran aber, dass das immer Räume sind, die für eine bestimmte Menschengruppe gemacht sind, auch so funktionieren und bestimmte Leute inkludieren. Bei Inklusion passiert immer gleichzeitig, dass exkludiert wird. Bestimmte Personengruppen werden also ausgeschlossen. Wir leben schließlich nicht in Städten, in denen nur Mauern sind. Menschen können sich hierzulande frei bewegen und deshalb vermischen sich die Personengruppen auch. Und verschiedene Personengruppen mit ganz verschiedenen Interessen nutzen die jeweils selben Räume. Da kommt es natürlich zu Konflikten und das ist auch gut, weil sich auf diese Weise Meinungen und auch Räume weiterentwickeln können. Da haben wir angesetzt und wollten durch die Erweiterung in das Digitale konkrete physische Räume in der Stadt Wien, im Konkreten im 9. Bezirk, neu beleuchten.
TM: Es sind teilweise sehr persönliche Räume entstanden, die sich bestimmten Themen gewidmet haben. Es gab zum Beispiel einen Angstraum. Das war ein Raum, in dem sich das Gefühl der Angst irgendwie widergespiegelt hat. Das wiederum sollte dazu anstoßen, dass Menschen über ihre eigenen Erfahrungen in öffentlichen Räumen sprechen und dass sie sagen, welche Räume ihnen Angst machen. Und was zum Beispiel die Komponenten dafür sind, dass ein Raum diese Emotion vermittelt: dass es vielleicht dunkel ist, oder dass dort einfach nicht so viele Menschen sind; dass er vielleicht unterirdisch ist; dass sich dort bestimmte Menschengruppen aufhalten, denen man abends vielleicht nicht so gerne begegnen wollen würde.
JPL: Genau. Der Austausch darüber kann vielleicht schon dazu führen, dass man vielleicht weniger Angst davor hat, diese Räume zu nutzen. Es gab im Allgemeinen viele Räume, in denen persönliche Geschichten geteilt werden konnten. Zum Beispiel gab es einen, in dem verschiedene Geschichten und Erfahrungen aus der Straßenbahn erzählt werden konnten. Ebenso eröffnete sich wie bereits gesagt ein Dating-Room, in dem Leute sich ein Profil anlegen konnten, um sich zu daten. Es gab den Komplex der Leerstände. Leute konnten einfach neue Räume der Commons an bestimmten Leerständen verorten und gemeinsam überlegen, was mit dem Raum gemacht werden könnte, wie eine Gruppe ihn nutzen könnte oder wie eine neue Gemeinschaft durch die Nutzung dieser Räume entstehen könnte.
TM: Dann haben wir einen Raum bei der Festivalzentrale der Vienna Design Week eröffnet, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu artikulieren, was ihr Lieblingsteil der Design Week war. Das war sozusagen ein Raum des Diskurses. Außerdem haben wir gemeinsam mit den Schüler*innen, die wir bereits angesprochen haben einen Raum für SchülerInnen erstellt. Sie haben selbst festgelegt, wer Teil dieses Raumes ist, wer ihn betreten darf und wer nicht. Das ist in einer recht politischen Diskussion ausgeartet und war augenöffnend, weil wir gemerkt haben, dass diese Schüler*innen das Bedürfnis hatten, zu sprechen und gehört zu werden – auch politisch.
JPL: Das war zur Zeit der Wahlen. Die Schüler*innen waren etwa 14 bis 15 Jahre alt. Sie hatten also noch kein Wahlrecht inne, hatten aber eine stark ausgeprägt politische Meinung. Was macht man mit dieser Meinung? Das war in diesem Fall ein Thema. Man verbreitet seine Meinung auf Facebook und ist sich nicht über die Folgen bewusst, die diese Meinungsäußerung vielleicht haben kann. Denn es betrifft einen ja nicht wirklich physisch, wenn verschiedene Reaktionen kommen. Dann macht man den Computer eben aus. Aber was passiert eigentlich, wenn man das mit dem physischen Raum in Verbindung bringt? Was passiert, wenn diese Meinungsäußerung tatsächliche Auswirkungen auf den Raum und auf die Menschen hat? Das mit den Schüler*innen zu diskutieren, fanden wir sehr spannend und hat sofort funktioniert.
Welche Rolle spielte in diesen Räumen das Experimentieren? Oder das Ausprobieren von Neuem? Oder künstlerische, kulturelle Praktiken?
JPL: Ich glaube, da müssen wir noch einmal betonen, dass SISI in Wien ein Erstversuch war. Es war ein experimentelles Projekt, basierend auf einer Idee, die wir einfach mal in den Raum geworfen und ausprobiert haben. Das ist oft so. Da braucht es jetzt wieder Zeit, um Konzepte anzupassen, sodass die Leute in das Projekt involviert werden wollen und sich Ideen aneignen.
TM: Ich glaube, in der Wunschvorstellung ist es so, wie Jan Phillip das gerade beschrieben hat. Es kommt aber auch darauf an, welche Personen Teil eines Projekts sind oder werden wollen. Nicht jede*r hat eine künstlerische Idee, wie sie*er sich ein bestimmtes Thema aneignet. Wir haben verschiedene Tools zur Verfügung gestellt. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass das Erstellen von Fotos ein Weg sein kann, sich Themen anzueignen. Eine andere Möglichkeit waren Voice-Memos, die man hochladen hätte können. Das heißt, man hätte auch Sound aufnehmen können. Man hätte auch selbst Audioaufnahmen oder Videos machen oder eine Fotoreihe erstellen können. Aber das war gar nicht das Ziel. Der Raum war offen, sodass diese Praktiken Optionen darstellten, aber nicht verpflichtend oder gar notwendig waren.
JPL: Beteiligung und Interaktion sind in diesem ersten Versuch in Wien nur teilweise passiert. Einige Gründe dafür haben wir bereits genannt. Ein weiterer besteht darin, dass Tools oft viele Schritte und Regeln haben, die man erstmal durchschreiten muss. Da braucht es schon ein großes Interesse, dass die Leute von Anfang bis Ende dabei sind.
TM: Ich glaube, man kann sagen, dass es in den Räumen selbst wenig künstlerische Beteiligung gab. Aber in der Findung der Räume hat sich für uns herauskristallisiert, dass wir selbst immer kreativer wurden, was neue Räume angeht. Unsere Grafikerin hat zum Beispiel mit einem Freund einen Raum aufgemacht, wo man in einen kleinen Tunnel geht und sich danach in ein Tier verwandelt. Das war ein spielerischer Zugang, den öffentlichen Raum anders zu nutzen. Diese Verspieltheit hineinzubringen war schön.
JPL: Ich glaube, es ist wichtig, dass man Fragen spielerisch angeht. Es gab zum Beispiel den Raum Public Playlist. Das war ein Raum von Zaha Hadid in einem Gebäude am Donaukanal, das jetzt das Schicksal hat, ein Leerstand zu sein. Dort wurde ein Raum eingerichtet, wo Leute ihre Lieblingsmusik teilen und sich treffen konnten, um gemeinsam dieses Leerstandsareal neu zu beleben. Das ist genau dieses Spielerische, Künstlerische, Experimentelle, das für einige gut funktioniert. Andere brauchen eine klare Funktion, eine Funktionalität und einen funktionalen Mehrwert. Im besten Fall ergibt sich die Nutzung aus dem Prozess und aus den Menschen heraus, wir als Künstler*innen wollen nur den Anstoß geben.