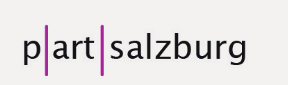Kann man sich das Transformationszentrum als physischen Raum vorstellen? Ist es ein Experimentierraum, der für verschiedene Menschen zugänglich ist, oder ist es ein Konzept auf einer Metaebene?
Das Karlsruher Transformationszentrum ist ein organisationales Gebilde. Wir haben aber seit 2015 einen physischen Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft in der Karlsruher Oststadt.3 Das ist das physische Herz unseres Reallabors. Dort steht inzwischen auch das Klingelschild für das Karlsruher Transformationszentrum. Das heißt, es gibt schon eine Verortung, aber es ist bislang kein riesiger Ort. Einen solchen würden wir uns wünschen. Ich würde sagen, die Zielrichtung geht klar dahin. Und weiter gefasst auch dahin, Experimentierräume nicht nur temporär in der Stadt zu eröffnen, sondern auch eigene zu haben. Ich könnte mir gut vorstellen, mittelfristig Werkstätten zu haben, die für Ideen vermietet oder zur Verfügung gestellt werden können, seien sie technischer oder künstlerischer Art. Letztlich ist das ja egal. Hauptsache, sie leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. So weit sind wir aber noch nicht. Momentan ist das Transformationszentrum ein Konzept mit dem bestehenden Zukunftsraum als Herzstück.
Spielt der Aspekt der Kunst bei Ihnen eine größere Rolle? Ihre Publikation etwa ist wirklich gut aufbereitet, vor allem auch in einer sehr ansprechenden künstlerischen Form. Deshalb auch meine Frage.
Wir haben schon eine Affinität zur Kunst. Ästhetik und Schönes sind uns wichtig. Wir haben keine Künstler*innen im Team, aber kunstaffine Mitarbeiter*innen. Auf die grafische Gestaltung legen wir besonderen Wert. Neben dem Inhalt ist uns auch die Form wichtig. Ich glaube, man merkt das am besten an unseren Veranstaltungen, insbesondere was die Atmosphäre betrifft. Und wir machen auch immer wieder kleinere Projekte mit Künstler*innen zusammen. Wir möchten den Kunst- und Kulturbereich aber gerne noch mehr integrieren. Hier gibt es noch Potenzial. Gerade läuft z.B. ein Antragsverfahren, im Rahmen dessen das Badische Staatstheater, das in Karlsruhe ansässig ist, sich eingeklinkt hat. Auch die Leiterin des Kulturamts der Stadt Karlsruhe ist unseren Ideen gegenüber sehr offen.
Sie haben jetzt mehrfach angesprochen, dass ein Kernanliegen von Reallaboren neben der Wissenschaft darin bestehe, Gesellschaft zu gestalten. Dazu ist der Dialog mit verschiedensten Menschen aus Zivilgesellschaft, aus Hochschulen, aus Unternehmen etc. wesentlich. Wie gelingt es Ihnen, mit den Menschen – auch jenen, die man schwerer erreicht – in den Dialog zu treten, sie ins Boot zu holen und sie auch zu halten? Sie haben gesagt, dass Sie direkt in die Bevölkerung hineingehen. Wie machen Sie das? Wie kann man sich den gemeinsamen Prozess des Arbeitens, Entwickelns und Experimentierens vorstellen?
Eine der Haupterfahrungen unsererseits ist, dass genau dieser Aspekt viel Vertrauen und viel Kommunikation braucht. Und dafür benötigt man Zeit, die man sich auch nehmen muss. An ein Reallabor, das einigermaßen stabil sein soll, geht man am besten mit keinem großen Zeitdruck heran. Da geht eher etwas kaputt, als dass etwas langfristig aufgebaut wird. Aus der wissenschaftlichen Arbeit kommend würde ich sagen, dass man ungefähr doppelt so viel Zeit für ein Reallaborprojekt braucht wie für ein entsprechendes Forschungsprojekt.
Wenn man diese Zeit hat, wie gelingt Reallaborarbeit dann? Man muss die Leute treffen. Man muss das, was die Leute bewegt, treffen. Das wiederum ist ganz unterschiedlich. Die Künstler*innen und die Dame vom Kulturamt haben ganz andere Vorstellungen oder Berührungspunkte als Technikfreaks, die selbstständig Solarzellen entwickeln oder sich irgendwo im Haus oder im Häuserblock ein Blockheizkraftwerk einbauen. Wiederum ganz andere Vorstellungen und Interessen hat die Stadtverwaltung, die darauf achtet, ‚ordentlich‘ mit der Stadt Karlsruhe zu haushalten und vielleicht Klimaschutz auf dem Plan hat, aber nicht weiß, wie diese beiden Aspekte zusammengehen können. Die Ansprüche und Aufgabenstellungen, die im Reallabor auf einen zukommen können, sind also sehr unterschiedlich. Wichtig ist, sich darauf einzulassen, Verständnis zu entwickeln, Verständigung und adressat*innenspezifische Kommunikation zu betreiben, Zeit mitzubringen und offen zu sein. Offen und authentisch zu sein ist auch wichtig. Wir machen das zumindest so. Es kann aber auch sein, dass man anders durch die Welt kommt. Wir versuchen jedenfalls, authentisch zu sein und auf diese Weise Verbündete zu finden, die das goutieren und sagen: „Ja, die sind echt und wir wollen etwas mit ihnen machen.“ Das gehört zum Vertrauensaufbau dazu.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, konkret zu werden. Diese Erfahrung haben wir bzw. habe zunächst ich gemacht. 2011, als ich die Idee hatte, Quartier Zukunft gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe zu initiieren, bin ich frohen Mutes mit dem Konzept an die Stadtverwaltung, Amtsleitung und Bürgermeister herangetreten. Ich dachte: „Das ist ein super Konzept. Da müssen sie doch mitmachen!“ Damit bin ich zunächst zwar nicht gegen Wände gelaufen, habe aber auf jeden Fall Irritation verursacht. Meine Idee war der Stadt Karlsruhe damals viel zu abstrakt und abgehoben. Sie konnten damit wenig anfangen. „Nachhaltige Entwicklung, ja! Aber wie? Was wollen Sie denn konkret machen, Herr Parodi?“ Erst an dem Punkt, an dem wir konkret und handfest wurden, wurden wir anschlussfähig für die Stadtverwaltung.
Der Aspekt des Konkret-Werdens spiegelt sich seither auch in den Veranstaltungen und Aktivitäten, die wir organisieren, wider. Bei vielen Veranstaltungen achten wir sogar darauf, dass die Sprache nicht im Mittelpunkt steht, sondern konkretes Handeln. Kleidertauschpartys etwa haben zunächst nichts mit Sprache zu tun. Ein Reparaturcafé geht auch weitgehend ohne oder zumindest mit wenigen Worten: „Kaputt.“ Dann ist klar, worum es sich handelt. Dann guckt jemand, die*der sich auskennt, was los ist. Wir haben zum Beispiel auch Pflanzentauschpartys gemacht, oder Möbelbauworkshops, wo man mit wenig Geld ganz einfache Möbel bauen kann. Solche Aktivitäten eignen sich, um Akteur*innen ins Boot zu holen, die sonst wenig am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben und auf Bürger*innenversammlungen oder Bürger*innenforen, die wir ebenso durchführen, nicht zu finden sind. Hier waren manchmal 200, 300 Menschen vor Ort: tolle Partizipationsprozesse. Wir haben aber erhoben, dass die meisten Teilnehmer*innen einen höheren Bildungsabschluss hatten. Ich glaube sogar, dass die Mehrzahl einen akademischen Abschluss hatte. Dann bewegt man sich einfach in einer bestimmten Klientel und an andere kommt man nicht heran. Da hilft es tatsächlich auch, konkret ins Handeln zu kommen, sodass die Sprache zur Nebensache wird.