„Kunst als Sprache muss nicht den gesellschaftlichen Normen oder Sitten entsprechen“
Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül
„Kunst ist die einzige Sprache, in der mir keine*r sagen darf, wie ich sie zu sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss. Die Sprache der Kunst, die ich sprechen möchte, ist antirassistisch“, erzählt die Medienkünstlerin Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül.
Die in Oberösterreich aufgewachsene Künstlerin mit türkischen und kurdischen Wurzeln teilt ihren Werdegang und formuliert klar, wo es im Kunst-und Kulturbetrieb dringend Veränderung braucht und wie dies, fernab von Tokenism, auch gelingen kann.
Du bist als Künstlerin tätig. Wie hast du dich dafür entschieden? Wie war dein Weg zu diesem Beruf?
Wenn mich jemand fragt, wie, wann, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Kunst hatte, antworte ich meist: Es war der gelbe Kassettenrecorder mit Mikrofonanschluss. In meiner Erinnerung habe ich die Sprache/n der Kunst viel früher entdeckt, als mir tatsächlich bewusst war. Ich war, glaube ich, sechs Jahre alt, als mein Vater einsah, dass ich mich nicht für das Gleiche wie andere Kinder interessierte. Ich bekam einen Kassettenrecorder, mit dem ich zum ersten Mal mit dem angebundenen Mikrofon meine Stimme aufnahm und sie auch zum ersten Mal hören durfte. Ich war begeistert. Ich hatte sofort den Bedarf, dieses der ganzen Welt vorzuführen. Meine Welt bestand aus einem kleinen Dorf im Mühlviertel/OÖ, wo gerade mal zehn Häuser zu entdecken waren. Ich klopfte an die Tür der Nachbar:innen und führte schlicht und einfach Interviews.
Im Laufe der Zeit habe ich erfahren, dass das Interesse an der Kunst nicht von heute auf morgen kam, sondern dies schon in der Familie durch Silber- und Schmuck- sowie Keramik- und Glasproduktion existierte. Meine Familie war in Bezug auf meine Interessen und meine Schul- und Universitätslaufbahn, die mit vielen Hindernissen und Diskriminierungen einhergingen, eine sehr große Unterstützung.
Wie verlief denn die Schulzeit für dich?
Schule sollte ein sicherer Ort für alle Kinder und Jugendlichen sein, wo sie sich weiterbilden können und in ihren Interessen gefördert werden. Am Land war die Grundschule ein Ort, wo ich viel lernen und viel umsetzen konnte. Ich war ich. Ich durfte Wände mit meiner Kunst bemalen, ich durfte meine künstlerischen Arbeiten ausstellen, die Bücherei war meine Heimat. Leider hörte dieses Ich-sein-können in der städtischen Oberstufe auf. Es war ein Ort, wo ich mich verloren hatte, mich selbst nicht wiederfinden konnte, weil ich nicht ich selbst sein durfte.
Kunst ist die einzige Sprache, wo mir keine*r sagen darf, wie ich sie zu sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss.
Als ich dann, nach vielen Hürden, an die Uni kam, hatte ich das Gefühl, dass es ein Ort war, an dem ich wieder aufatmen durfte; auch wenn der Universitätsbereich stark weiß geprägt ist und überwiegend weiße Kunst und weiße Literatur wiedergibt. Ich hatte viele weiße, vorwiegend männliche, Studienkolleg:innen und Professor:innen. Nichtsdestotrotz bekam ich und schuf ich mir kreative Räume. Räume, um Dinge neu zu hinterfragen und neu zu definieren. Bestehendes Wissen neu zu ordnen, auf neue Räume zu deuten, und andere dabei mitzunehmen. Es war sozusagen ein „back to who I am and can be“. Kunst ist die einzige Sprache, wo mir keine*r sagen darf, wie ich sie zu sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss. Die Sprache der Kunst muss antirassistisch sein. Kunst als Sprache muss nicht den gesellschaftlichen Normen oder Sitten entsprechen. Sie kann ein Sprachrohr für Künstler:innen sein.
Ich kann mich noch sehr gut an meine Arbeitsmappe und das Aufnahmeverfahren erinnern, bei dem mich die Kommission fragte, warum ich denn bei einem der Werke aufgehört hatte, es zu vervollständigen. Ich erklärte, dass ich aufgehört hatte zu zeichnen, weil meine Emotionen die höchste Priorität hatten und somit das Werk auch „unvollendet“ bleiben konnte. Die Antwort des Professors war: „Eine interessante Herangehensweise!“. Ich hatte Eindruck in diesem Sinne hinterlassen.
Artwork: light of emotions
Und was machst du aktuell? Bist du aktuell auch als Künstlerin tätig?
Ich habe mich entschieden, eine Zeit lang auch in anderen Feldern wie im Bereich des Projektmanagement und der Workshop-Facilitation zu Rassismuskritik im Kunst- und Bildungsbereich tätig zu sein, Erfahrungen zu sammeln, um mein Outreach- und Organisations-Know-how in der Praxis zu vertiefen und mir eine Palette an Expertisen anzueignen. Aktuell beschäftige ich mich als Künstlerin mit dem Thema Emotionen und Transgenerationalität.
D/Arts weist ganz klar auf Mängel und Probleme im Kunst- und Kulturbetrieb hin, thematisiert und spricht ganz offen über Diskriminierung und Rassismus.
Wie bist du bei D/Arts involviert? Was aus deiner Arbeit bringst du bei D/Arts ein?
Ich habe das D/Arts Team über eine Veranstaltung von einer Freundin, die selbst im Team ist, kennengelernt. Ich habe feststellen können, wie Menschen zusammenkommen, die enorm viel Wissen, Praxiserfahrung sowie Leidenschaft mitnehmen und diese auch weitergeben möchten. Es sind Expert:innen, die bereit sind, ihre Expertisen auszutauschen und zusammenzuarbeiten. D/Arts weist ganz klar auf Mängel und Probleme im Kunst- und Kulturbetrieb hin, thematisiert und spricht ganz offen über Diskriminierung und Rassismus.
Denn aktuell spiegelt sich die Realität einer diversen Gesellschaft in der dominierenden Kunst- und Kulturlandschaft nach wie vor kaum beziehungsweise nicht ausreichend wider. Ungehörten und aktiv verdrängten Stimmen steht der bereits lange eingeforderte Raum zu. Es geht darum, das offen anzuerkennen und Platz zu machen. Die Auseinandersetzung mit und Bewusstseinsschaffung für Unterdrückungssysteme und ihre Strukturen waren, sind und sollten vermehrt ein essenzieller Bestandteil von Kunst und Kultur werden.
Durch meine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kunst und Medien, Kunstvermittlung, Management sowie Training und Workshop-Facilitation bis hin zur Rassismuskritik im Kunst- und Bildungsbereich weiß ich, dass es mit D/Arts gelingt, Sichtbarkeit, eine Stimme und eine neue Sprache zu vermitteln, um das bestehende Netzwerk zu erweitern.
Was ist bei D/Arts deiner Meinung nach besonders gut verlaufen und wo siehst du die größten Herausforderungen?
Was mir besonders gut an D/Arts gefällt, ist, dass es die Transformation, sozusagen Neu/-und Umgestaltung des Kulturbetriebs anstrebt – als eine aufrichtige Stelle für sowie mit Kunst- und Kulturschaffende/n. Es wird ein vielfältiges Programm in Form von Diskussionen, Konferenzen, Workshops oder Kunstproduktionen angeboten und mit Expert:innen und Netzwerkpartner:innen umgesetzt. Einer der wichtigsten Punkte der Diversitätsentwicklung im Kulturbetrieb ist es, diskriminierungs- und rassismusfreie/re Räume zu schaffen. D/Arts weist darauf hin und thematisiert, was bei einer sehr privilegierten und männlich weiß dominierten Kulturlandschaft die Herausforderungen sind.
Es ist wichtig, Differenzen anzuerkennen und gleichzeitig Raum für das Entdecken von Gemeinsamkeiten zu schaffen und in Folge wunderschöne Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zu akzeptieren und zu respektieren.
Was verstehst du unter Diversität? Auf welche Konzepte und theoretische Bezüge greifst du zurück?
Ich bin sichtbar und meine Biographie, die intersektional ist, auch. Diversität, das bin ich. Diversität war schon immer da. Sie muss sozusagen nicht neu erfunden werden. Sie ist die Gesellschaft. Diversität anzuerkennen, bedeutet, alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer physischen oder psychischen Fähigkeiten anzuerkennen und wertzuschätzen. Diversität ist ein zentraler Bestandteil des künstlerischen Prozesses, treibt diesen voran und bringt Menschen zusammen. Es ist wichtig, Differenzen anzuerkennen und gleichzeitig Raum für das Entdecken von Gemeinsamkeiten zu schaffen und in Folge wunderschöne Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zu akzeptieren und zu respektieren.
Es ist aber auch so, dass dieser Begriff immer öfter Teil einer Marketingstrategie wird. Institute, Unternehmen oder NGOs stellen Minderheiten ein oder ‚benötigen‘ für Marketingkampagnen Bilder von BIPOC. Problematisch wird es, wenn Tokenism und „Woke-Washing“ angewandt werden – also ein positives Bild schaffen zu wollen, dass nur den PR-Aktionen dient, mit der Hoffnung dadurch einer großen Reichweite zu erzielen. Von Woke-Washing spricht man, wenn ein Unternehmen, eine Institution oder eine Einzelperson etwas sagt oder tut, dass ihr Eintreten für eine soziale Sache signalisiert, wie eben das Einstehen gegen u.a. rassistische und sexistische Diskriminierung, gleichzeitig aber selbst gegensätzlich oder gar nicht handelt.
In sich diskriminierend können diese Diversity-Kampagnen dann sein, wenn sie nur auserwählte und für sie brauchbare Menschen als divers darstellen. Häufig aber, wenn eine sichtbare muslimische Person of Color mit Kopfbedeckung für eine Kampagne vorspricht, wird diese abgewiesen, weil man damit sozusagen die Kund:innenschaft oder die Klient:innen abschrecken oder gar verlieren könnte.
Wenn man mit Diversität arbeiten möchte, dann heißt dies, strukturelle Veränderung mitzugestalten und Sichtbarkeit bzw. Repräsentation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu schaffen.
Welche konkreten Maßnahmen braucht es, um den Kulturbetrieb gerechter und diverser zu machen? Welche Akteur:innen braucht es? Auf welchen Ebenen braucht es Veränderung?
Es braucht eine dringende strukturelle Veränderung und das bedeutet radikale Veränderungen in den Institutionen. Es ist nicht damit getan, wenn hier und da einmal Künstler:innen ‚aus dem Ausland‘ eingeladen werden oder sie ab und zu kuratieren, um das Image und den Outreach zu fördern. Das größte Problem sind die Strukturen und die damit einhergehenden hierarchisch-strikten Entscheidungs- und Machtpositionen. Migration und Diversität ist in der Geschichte schon viel früher verankert und die Gesellschaft sollte diese abbilden. Warum kann es heute nicht möglich sein, BIPOC mit Wissen und (Praxis-)Erfahrung in den Entscheidungspositionen zu sehen und Raum für Menschen zu schaffen – also Macht umzuverteilen? An weiß geprägten Instituten sind es großteils weiße (weiß gelesene) und somit privilegierte Kurator:innen, die Ausstellungen zu verschiedenen und intersektionellen Identitäten sowie internationaler Kunst leiten, die Theateraufführungen, Musicals usw. kuratieren.
Wenn man mit Diversität arbeiten möchte, dann heißt dies, strukturelle Veränderung mitzugestalten und Sichtbarkeit bzw. Repräsentation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu schaffen. In diesem Sinne ist es wichtig, Machtverhältnisse und Privilegien zu hinterfragen und offen anzusprechen. Wer sind die Entscheidungsträger:innen? Wie werden die Subventionen verteilt? Wir müssen weg von Diversity im Sinne von Tokenism – hin zu einer Realität, die die wahre Bevölkerung widerspiegelt.
Es ist an der Zeit, vermehrt Raum und Sichtbarkeit für Menschen, die beispielsweise keine weißen Privilegien genießen, zu schaffen – und zwar selbstbestimmt und ohne durch Dominanz geprägte Vorgaben –, die uns einige wirklich grundlegende Wahrheiten über die Gesellschaft, in der wir leben, sagen können. Wir müssen den Prozess beschleunigen, durch den oft verdrängte Menschen sichtbar werden und sich Gehör verschaffen können. Wenn wir das nicht tun, werden sich die Künste weiter von der Gesellschaft weg entfernen.
Was sind für dich gute Beispiele in Hinblick auf Diversität und mehr Gerechtigkeit im Kulturbetrieb?
Institutionen, Universitäten, Arbeitgeber:innen erkennen mittlerweile immer mehr an, dass interne Fortbildungen und Sensibilisierung im Bereich Antirassismus notwendig sind. Wissen aneignen, zuhören, umsetzen und anerkennen sind wichtige Schritte. Nur Projekte und Ausstellungen, die auf diverse Realitäten und deren Geschichte aufmerksam machen, genügen hierbei nicht. Viele Kunst- und Kulturschaffende leisten in verschiedenen Instituten und NGOs tagtäglich ehrenamtliche Arbeit, die nicht angerechnet oder wertgeschätzt wird. Das benötigt drastische Veränderung; Menschen müssen für ihre Expertise entgeltet werden.
Wie nimmst du den Kulturstandort Salzburg wahr?
Ich kenne die Stadt Salzburg gut – es ist ja auch eine Stadt, wo viele kreative Köpfe mit wertvoller Geschichte zusammenkamen und nach wie vor zusammenkommen. Damit meine ich natürlich nicht Mozart. Ich habe Freund:innen und Bekannte, sichtbare BIPOC, die sich in verschiedenen Bereichen in der Stadt engagieren und etwas sehr Wertvolles in der Stadt leisten. Leider werden sie im Kunst- und Kulturbetrieb nicht so repräsentiert. Tourismus alleine macht eine Stadt nicht divers. Nur die Beteiligung an der Struktur selbst, zeigt, dass Menschen eine Sprache haben.
Zehra Baraçkılıç, Dilan Sengül ( 2022): „Kunst als Sprache muss nicht den gesellschaftlichen Normen oder Sitten entsprechen“. Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 13 , https://www.p-art-icipate.net/kunst-als-sprache-muss-nicht-den-gesellschaftlichen-normen-oder-sitten-entsprechen/

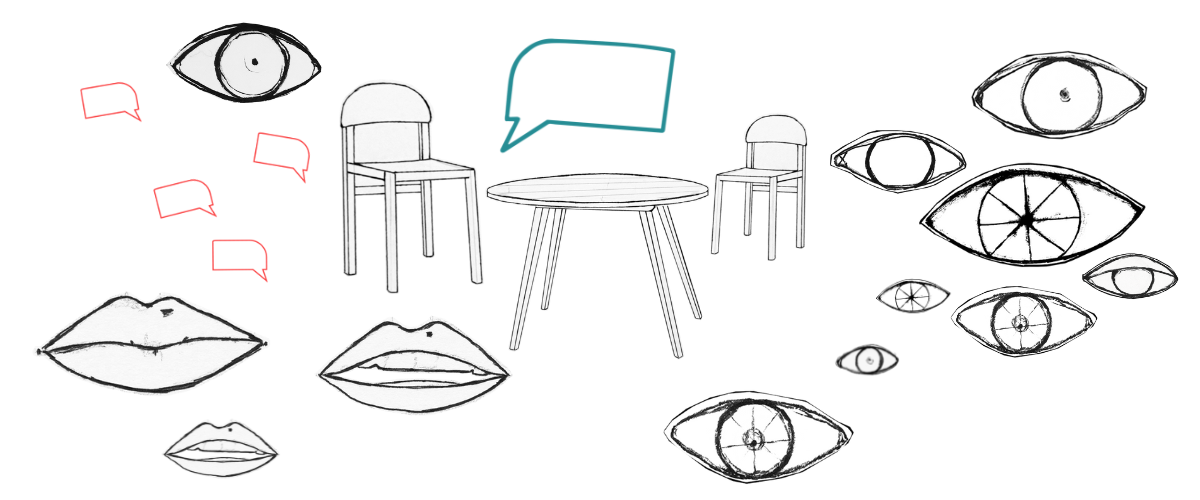




 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis