Diversitätsorientierung in und durch Kulturpolitik
Forderungen aus der Praxis und Handlungsoptionen
Für einen umfassenden und langfristigen Wandel hin zu mehr Diversität und sozialer Gerechtigkeit in Kunst und Kultur bedarf es grundlegender und weitreichender struktureller Veränderungen. Der vorliegende Beitrag*1 *(1) geht der Frage nach, wo Österreichs Kulturpolitik und -verwaltung ansetzen können, um den Kulturbetrieb offener und gerechter zu machen. Welche Praktiken und Übereinkünfte in Bezug auf Kunst dominieren das kulturpolitische Feld? Welche inhaltlichen Aktualisierungen und konkreten Maßnahmen braucht es, um Diskriminierungen entgegenzuwirken? Der Beitrag knüpft an Beobachtungen sowie Erfahrungen von in Kunst und Kultur tätigen Personen an und führt Erkenntnisse zusammen, die aus dem Forschungsprojekt Kulturelle Teilhabe in Salzburg (2017–2021)*2 *(2) hervorgingen.
Die Erkenntnis, dass der Kulturbetrieb die Normalität unserer von Diversität gekennzeichneten Migrationsgesellschaft nicht widerspiegelt und weite Teile der Gesellschaft davon aktiv ausgrenzt, ist keineswegs neu. Ebenso wenig die damit einhergehende Forderung nach Transformation, um das Feld von Kunst und Kultur insgesamt gerechter sowie für marginalisierte Gruppen relevant und zugänglich zu machen. Die gesetzlichen Bestimmungen sind diesbezüglich eindeutig: Diskriminierungsverbot sowie das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert.*3 *(3) Für die Durchsetzung dieser Rechte zu sorgen, ist demnach eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand und der durch sie geförderten Institutionen.
Tatsächlich haben Diversität und Antidiskriminierung seit Kurzem als Themen Eingang in die österreichische Kulturpolitik gefunden. So benennt das Land Salzburg in dem 2018 veröffentlichten Kulturentwicklungsplan KEP Land Salzburg als eines seiner grundsätzlichen Ziele, dass es sich dem „Ideal einer gleichberechtigten Gesellschaft folgend, […] zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung von Menschen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung oder des Geschlechts und zur Förderung einer nachhaltigen Chancengleichheit“ bekennt (Land Salzburg 2018: 13). (*15) Im Zwischenbericht zu dem im Herbst 2020 auf Bundesebene gestarteten Fairness Prozess ist zu lesen: „Die künstlerische und kulturelle Arbeit von Menschen aus marginalisierten Gruppen soll in Zukunft mehr in den Fokus rücken. […] So divers die österreichische Gesellschaft ist, so divers soll auch ihre Kunst und deren Publikum werden.“ (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2021a: 13)
(*15) Im Zwischenbericht zu dem im Herbst 2020 auf Bundesebene gestarteten Fairness Prozess ist zu lesen: „Die künstlerische und kulturelle Arbeit von Menschen aus marginalisierten Gruppen soll in Zukunft mehr in den Fokus rücken. […] So divers die österreichische Gesellschaft ist, so divers soll auch ihre Kunst und deren Publikum werden.“ (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2021a: 13) (*6) Sowohl im österreichischen Fairness Codex*4 *(4) als auch in der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes sollen „die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Künstler:innen aus marginalisierten Gruppen sowie die kulturelle Beteiligung von marginalisierten Menschen eine zentrale Rolle spielen“ (ebd.).
(*6) Sowohl im österreichischen Fairness Codex*4 *(4) als auch in der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes sollen „die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Künstler:innen aus marginalisierten Gruppen sowie die kulturelle Beteiligung von marginalisierten Menschen eine zentrale Rolle spielen“ (ebd.). (*6) Als konkreter Schritt wurde bereits in allen neuen Ausschreibungen „Diversität als berücksichtigungswürdiges Kriterium“ eingefügt, wodurch Auswahlgremien angehalten werden sollen, die Diversität der Beteiligten bei der Bewertung der Anträge zu berücksichtigen. Außerdem soll eine Neufassung der Geschäftsordnung für Beiräte und Jurys zu einer Diversitätsentwicklung beitragen, indem darin „die Berücksichtigung aller gesellschaftlicher Gruppen explizit verankert“ wurde (vgl. ebd.).
(*6) Als konkreter Schritt wurde bereits in allen neuen Ausschreibungen „Diversität als berücksichtigungswürdiges Kriterium“ eingefügt, wodurch Auswahlgremien angehalten werden sollen, die Diversität der Beteiligten bei der Bewertung der Anträge zu berücksichtigen. Außerdem soll eine Neufassung der Geschäftsordnung für Beiräte und Jurys zu einer Diversitätsentwicklung beitragen, indem darin „die Berücksichtigung aller gesellschaftlicher Gruppen explizit verankert“ wurde (vgl. ebd.). (*6)
(*6)

Aikins, Joshua Kwesi/Gyamerah, Daniel (2016): Handlungsoptionen zur Diversifizierung des Berliner Kultursektors. Eine Expertise von Citizens For Europe, Berlin. Online: https://vielfaltentscheidet.de/wp-content/uploads/2017/04/Final-für-Webseite_klein.pdf (11.07.2022).

Al-Masri-Gutternig, Nadja/Rosenhammer-Daoudi, Monika (2021 [2020]): Das inklusive Museum – eine Frage von Kooperation und Vernetzung Grundlagen. Interview, geführt von Persson Perry Baumgartinger und Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_PPB_DA_Al-Masri-Gutternig_Daoudi-Rosenhammer_print_ka_sr_final.pdf (11.07.2022)

Bakış, Onur (2021 [2019]): „Unsere Stärke liegt in der Mobilität – wir können in jede Ecke, in jede Siedlung, in jede Nische.“ Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2019/10/Interview_DA_Bakis_kw.pdf (11.07.2022)

Baumgartinger, Persson Perry (2021): Kulturarbeit & Diversity. Ein- und Ausschlüsse im Salzburger Kulturbetrieb. Essay. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Essay_PPB_Kulturarbeit_mb_final.pdf (11.07.2022).

Bourdieu, Pierre (1987 [1979]): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/Main: Suhrkamp (22. Auflage).

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (Hg.) (2021a): Fairness. Kunst und Kultur in Österreich. Zwischenbericht zum Fairness Prozess 2020/2021. Broschüre. Online: https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:e1dd8f82-4f31-4da3-a9a3-8cb15a42b5f3/Fairness%20Brosch%C3%BCre.pdf (11.07.2022).

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (Hg.) (2021b): Kunst Kultur Bericht 2020. Online: https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:1e6f1ff8-0285-472c-aadd-49a4a83c9fbb/KunstKulturBericht2020.pdf (11.07.2022).

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (Hg.) 2022: Fairness Codex. Kunst und Kultur in Österreich. Online: https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf (28.07.2022).

Felice, Conny (2021 [2019]): „Ich sehe da die Möglichkeit der Buntheit …“ –
Über LGBTIQ+, kulturelle Bildung und kulturelle Bildung. Interview, geführt von Persson Perry Baumgartinger. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_PPB_Felice_print_mb_final.pdf (11.07.2022).

Folie, Andrea (2021 [2019]): „Das Dorf wird noch globaler werden“ – Digitale
Teilhabe, Potenziale und Herausforderungen im Rahmen regionaler Kulturarbeit in Salzburg. Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_DA_Folie_print_am_sr_final.pdf (11.07.2022)

Hummer, Andrea (2021 [2020]): Nicht wie ein UFO in einer Region landen. Interview, geführt von Anita Moser. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_AM_Hummer_sr_rg_am_ka_Bio-passt_sr.pdf (11.07.2022).

INOU, simon (2021 [2018]): „Man muss jenseits der Politik agieren“. Interview, geführt von Anita Moser. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_AM_INOU.pdf (11.07.2022).

Karam, Abdullah (2021 [2020]): „More communication, please!“ – Über künstlerische Arbeit, das Potenzial von Computerspielen und Salzburg als Ort kultureller Teilhabe und Produktion. Interview, geführt von Anita Moser. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_AM_Karam.pdf (11.07.2022).

Kışlal, Aslı (2021 [2020]): diverCITYLAB: Ein kunstpolitisches Projekt, getarnt als Schule. Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_DA_Kislal.pdf (11.07.2022).

Krillin, Young (2021 [2019]): „Lokale Kunst sollte gefördert werden wie regionale Nahrungsmittelherstellung eben auch.“ Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_DA_Krillin_print_ka_sr_final.pdf (11.07.2022).

Kulturrat Österreich (2021): Fair Pay Reader. Online: https://kulturrat.at/wp-content/uploads/2021/09/Fair_Pay_Reader_KulturratOesterreich_2021.pdf (11.07.2022).

Land Salzburg (Hg.) (2018): Kulturentwicklungsplan KEP Land Salzburg. Visionen, Ziele, Maßnahmen. Online: https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Documents/WebNeu_Kulturentwicklungsplan.pdf (11.07.2022).

Lôbo Marissa/Seefranz, Catrin (2021 [2020]):„Es ist an der Zeit, zu schauen, was unabhängig von Staat oder von Institutionen möglich ist“. Interview, geführt von Persson Perry Baumgartinger und Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_PPB_DA_Lobo_Seefranz_print_kw_final.pdf (11.07.2022).

Micossé-Aikins, Sandrine/Sharifi, Bahareh (2019): Kulturinstitutionen ohne Grenzen? Annäherung an einen diskriminierungskritischen Kulturbereich. In: Kulturelle Bildung Online: https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich (11.07.2022).

Özmen, Esra/Özmen, Enes (2021 [2019]): „Wo ist ein*e Migrant*in der Boss und sagt: ‚Das ist zu weiß.‘? Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2019/10/Interview_DA_Esrap_print_kw_final.pdf (11.07.2022)

Schmerold, Monika (2021 [2019]): „Eigentlich eine einfache Antwort: ‚Alle‘ ist ‚alle‘“. – Über Enthinderung im Kunst- und Kulturbereich als Menschenrechtsaufgabe Interview, geführt von Dilara Akarçeşme. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_DA_Schmerold_print_mb_final.pdf (11.07.2022)

Schmerold, Monika E. (2021): Kulturveranstaltungen barrierefrei und inklusiv. Leitfaden. Checkliste“, herausgegeben von Eva Veichtlbauer/Land Salzburg. Online: https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Documents/Kulturveranstaltungen%20barrierefrei%20und%20inklusiv.pdf (11.07.2022).

Schmidhuber, Eva (2021 [2020]): „Wir haben den Anspruch, in unserem Programm
die Gesellschaft in all ihrer Vielfalt abzubilden“. Interview, geführt von Elke Zobl. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_EZ_Schmidhuber_print_mb_final.pdf (11.07.2022)

Tritscher, Reinhold (2021 [2020]): „Partizipation setzt nicht nur voraus, dass ein Projekt offen ist“. Interview, geführt von Timna Pachner. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_TP_Tritscher_kw.pdf (11.07.2022)

Wimmer, Michael (2020a): Das Phantom der Demokratie. Eine kleine Geschichte der österreichischen Kulturpolitik. In: Ders. (Hg.): Kann Kultur Politik? Kann Politik Kultur? Warum wir wieder mehr über Kulturpolitik sprechen sollten. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 122–134.

Wimmer, Michael (2020b): Eine Kultur für alle! Über Kanons, Leitkulturen und über das, worum es in der Kultur wirklich geht. Blogbeitrag: https://michael-wimmer.at/blog/eine-kultur-fuer-alle-ueber-kanons-leitkulturen-und-ueber-das-worum-es-in-der-kultur-wirklich-geht/ (11.07.2022).
Dieser Text wurde erstmals veröffentlicht in: Wimmer, Michael (Hg.) (2022): Für eine neue Agenda der Kulturpolitik. Berlin/Boston: De Gryuter, S. 330-343. https://doi.org/10.1515/9783110791723.
Das Forschungsprojekt wurde am Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion der Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst durchgeführt. Details über das Projekt sind hier zu finden: https://www.p-art-icipate.net/projekt/projektinfo/ (11.07.2022).
Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 2, https://www.menschenrechtserklaerung.de/diskriminierungsverbot-3542/, und Artikel 27, https://www.menschenrechtserklaerung.de/kultur-3689/ (15.12.2021).
Zum Zeitpunkt der Zweitveröffentlichung des Beitrags liegt der Fairness Codex als Broschüre vor: https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf (29.07.2022). Vielfalt wird darin – neben Respekt & Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Transparenz – als einer von vier Grundwerten genannt. Handlungsbedarf wird u.a. in Bezug auf die „strukturelle[n] Diskriminierung von Menschen aufgrund wahrnehmbarer und nicht wahrnehmbarer Merkmale“ erkannt. „Daher möchten wir uns verstärkt um die Sichtbarkeit marginalisierter Perspektiven im Kultursektor kümmern. […] Wir wollen das Bewusstsein für Diversität in unseren jeweiligen Wirkungsbereichen stärken, eine offene Diskussion über Ausschlussmechanismen und Diskriminierung ermöglichen und in diesem Zusammenhang notwendige Impulse setzen.“ (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2022: 6). (*8)
(*8)
Die Booklets stehen hier als Download zur Verfügung: https://www.p-art-icipate.net/projekt/interviews/ (15.12.2021). Sämtliche im Beitrag zitierten Interviewpassagen sind den veröffentlichen Booklets entnommen.
Laut Bundeskunst- und Kulturbericht erhielten im Geschäftsjahr 2019/20 das Burgtheater eine Basisabgeltung von 47.404.000 € und die Wiener Staatsoper von 66.088.000 € (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2021b: 263). An den ArtSocialSpace Brunnenpassage gingen hingegen 55.000 € (vgl. ebd.: 440). https://www.bmkoes.gv.at/Service/Publikationen/Kunst-und-Kultur/kunst-und-kulturberichte.html (15.12.2021)
Die Absichten des Fairness Codex (vgl. dazu auch Fußnote 4 in vorliegendem Beitrag) hätten durchaus bestimmter formuliert werden können, indem beispielsweise anstelle von „wir möchten“ oder „wir wollen“ ein dezidiertes „wir werden“ bekundet wird (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2022: 6). Da der Codex explizit und ausschließlich auf dem Prinzip der Selbstbindung fußt (vgl. https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Fairness/Codex.html#:~:text=Ziele&text=Zielgruppe%20des%20Fairness%2DCodex%20sind,Codex%20in%20ihrer%20Arbeit%20anwenden, 28.07.2022), bleibt abzuwarten, wie sehr sich insbesondere Institutionen von Kulturpolitik und ‑verwaltung sowie staatliche Kultureinrichtungen davon inspirieren und leiten lassen.
In Deutschland geschieht dies beispielsweise durch das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Programm 360 – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. 2018–2023 werden verschiedene Kultureinrichtungen mit insgesamt 13,9 Mio. Euro gefördert. https://www.360-fonds.de/ (15.12.20121).
Anregungen dazu bietet der Creative Case for Diversity des Arts Council England, https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Equality_Diversity_and_the_Creative_Case_A_Data_Report__201920.pdf (15.12.2021).
Anita Moser ( 2022): Diversitätsorientierung in und durch Kulturpolitik. Forderungen aus der Praxis und Handlungsoptionen. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 13 , https://www.p-art-icipate.net/diversitaetsorientierung-in-und-durch-kulturpolitik/

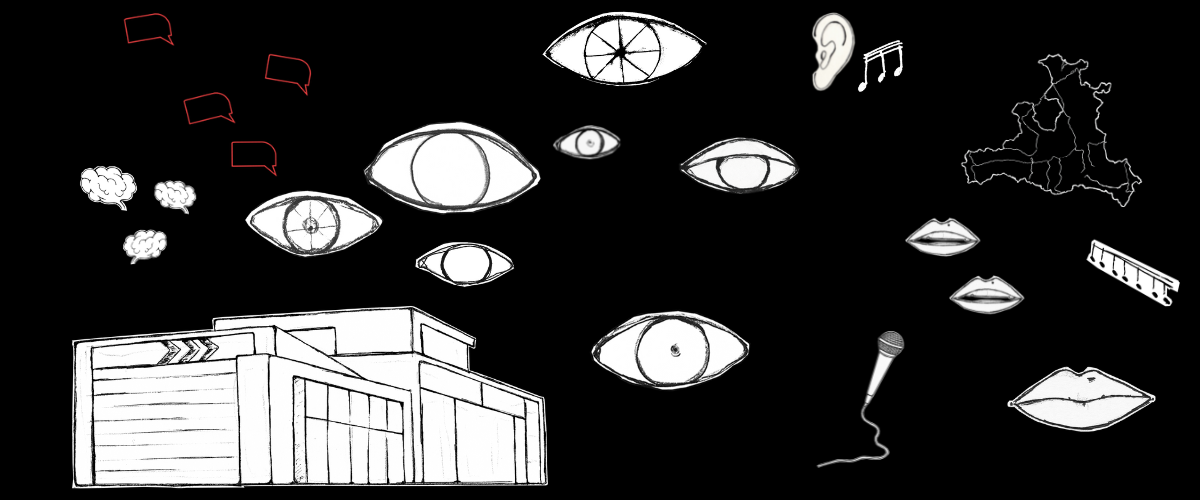
 Artikel drucken
Artikel drucken