Diskriminierungskritische Kulturpolitik und ihre Praxis
Am Beispiel der Strategischen Partnerschaft des Wiener Musikvereins mit der Brunnenpassage Wien*1 *(1)
„Kunst ist nicht nur eine Äußerung über die Gegenwart, sie kann auch Impulsgeberin für eine andere, bessere Zukunft sein. Daher gibt es nicht nur ein Recht, Kunst zu genießen, sondern auch eines, sie zu machen.“ (Tania Bruguera, Künstlerin, 2012) (*1)
(*1)
Der Zugang zu Kunst und Kultur, aber auch die Ermöglichung der Produktion von Kunst und Kultur stellt ein Grundrecht in demokratischen Gesellschaften dar (vgl. Zobl 2019). (*2)Dementsprechend lautet auch der kulturpolitische Auftrag an Kunst- und Kulturinstitutionen in Österreich, sich an die Gesamtheit der Bevölkerung zu richten. Dennoch sind unterschiedliche Gruppen bis heute auf vielen Ebenen von der Teilhabe im Kulturbetrieb ausgeschlossen und als Produzierende in den Kulturinstitutionen unterrepräsentiert (vgl. ebd.).
(*2)Dementsprechend lautet auch der kulturpolitische Auftrag an Kunst- und Kulturinstitutionen in Österreich, sich an die Gesamtheit der Bevölkerung zu richten. Dennoch sind unterschiedliche Gruppen bis heute auf vielen Ebenen von der Teilhabe im Kulturbetrieb ausgeschlossen und als Produzierende in den Kulturinstitutionen unterrepräsentiert (vgl. ebd.). (*2)
(*2)
Künstlerische Artikulation geschieht nicht außerhalb diskriminatorisch organisierter gesellschaftlicher Ordnungen und ist Teil von Diskursen und Praxen, mit denen bestimmte Bevölkerungsteile in ein „Wir“ einbezogen und andere ausgeschlossen werden (vgl. Bourdieu 2016; (*3)Meyer 2016
(*3)Meyer 2016 (*4)). Diskriminierungen erfolgen entlang unterschiedlicher Kategorien, aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Identität, des Alters, Be_Hinderung ebenso wie aufgrund sozio-ökonomischer Hintergründe, (vgl. Ahyoud et al. 2018)
(*4)). Diskriminierungen erfolgen entlang unterschiedlicher Kategorien, aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Identität, des Alters, Be_Hinderung ebenso wie aufgrund sozio-ökonomischer Hintergründe, (vgl. Ahyoud et al. 2018) (*5)aber auch Fragen von Weltanschauung, Religion oder Erstsprachen sind beim Thema Ausschluss zu berücksichtigen. Im Zusammenwirken ergeben diese einzelnen Ausschlussfaktoren – beispielweise ökonomische Benachteiligung verbunden mit Diskriminierung aufgrund von Rassismus – intersektionale Mehrfachbetroffenheiten. So sind etwa Akteur:innen, die bildungsbenachteiligt werden und zugleich von Rassismus betroffen sind, im Kulturbetrieb eine besonders unterrepräsentierte Gruppe (vgl. Ernst/Pilić 2021).
(*5)aber auch Fragen von Weltanschauung, Religion oder Erstsprachen sind beim Thema Ausschluss zu berücksichtigen. Im Zusammenwirken ergeben diese einzelnen Ausschlussfaktoren – beispielweise ökonomische Benachteiligung verbunden mit Diskriminierung aufgrund von Rassismus – intersektionale Mehrfachbetroffenheiten. So sind etwa Akteur:innen, die bildungsbenachteiligt werden und zugleich von Rassismus betroffen sind, im Kulturbetrieb eine besonders unterrepräsentierte Gruppe (vgl. Ernst/Pilić 2021).  (*6)
(*6)
Im vorliegenden Beitrag gehen wir der Frage nach, welche Ausschlüsse im kulturellen Feld wirkmächtig sind, welcher Handlungsbedarf sich ableiten lässt und wie unterschiedliche Strategien zusammengedacht werden können, um dem Versprechen von kultureller Teilhabe für eine pluralistische Gesellschaft nachzukommen.
Konzepte zur Öffnung von Kultureinrichtungen sind notwendig, um die gebremste Teilhabe von weiten Teilen der Bevölkerung zu überwinden (vgl. Pilić/Wiederhold-Daryanavard 2021). (*7)Dafür bedarf es zunächst der Einsicht, dass eine konzeptionelle Erweiterung und eine grundsätzliche Öffnung bedeutet, zu hinterfragen, wer in unserer Gesellschaft wie selbstverständlich zu einem „Wir“ gezählt wird und wer nicht. Noch immer werden etwa Migrant:innen nicht als Teil der Gesellschaft, des „Wir“, wahrgenommen und vielmehr als „fremde“ Bevölkerungsgruppen betrachtet (vgl. u.a. Bayer/Terkessidis 2017;
(*7)Dafür bedarf es zunächst der Einsicht, dass eine konzeptionelle Erweiterung und eine grundsätzliche Öffnung bedeutet, zu hinterfragen, wer in unserer Gesellschaft wie selbstverständlich zu einem „Wir“ gezählt wird und wer nicht. Noch immer werden etwa Migrant:innen nicht als Teil der Gesellschaft, des „Wir“, wahrgenommen und vielmehr als „fremde“ Bevölkerungsgruppen betrachtet (vgl. u.a. Bayer/Terkessidis 2017; (*8)Sharifi 2019;
(*8)Sharifi 2019; (*9)Mecheril 2016
(*9)Mecheril 2016 (*10)). Das betrifft nicht nur neu Zugezogene, sondern auch Menschen, die in der sogenannten zweiten oder dritten Generation geboren sind und sich immer noch nicht als vollständiger Teil der Gesellschaft verstehen dürfen (vgl. El-Tayeb 2018;
(*10)). Das betrifft nicht nur neu Zugezogene, sondern auch Menschen, die in der sogenannten zweiten oder dritten Generation geboren sind und sich immer noch nicht als vollständiger Teil der Gesellschaft verstehen dürfen (vgl. El-Tayeb 2018; (*11) Ernst/Pilić 2021
(*11) Ernst/Pilić 2021 (*6)).
(*6)).
Um eine solidarische und inklusive Vorstellung von einem „Wir“ voranzutreiben, ist es unabdingbar, die pluralistische und vielfältige Gesellschaft als Realität anzuerkennen (vgl. Yldiz 2021). (*12)So würde ein Abschied vom Integrationsparadigma*2 *(2) etwa bedeuten, sich auch im Kulturbetrieb von Sonderformen der Ansprache (etwa spezifische Projekte für „Geflüchtete“) zu lösen und vermehrt auf Strategien zu setzen, die die vielfältige Stadtgesellschaft zum Maßstab für kulturelle Teilhabe erheben (Vgl. Bayer/Terkessidis 2017).
(*12)So würde ein Abschied vom Integrationsparadigma*2 *(2) etwa bedeuten, sich auch im Kulturbetrieb von Sonderformen der Ansprache (etwa spezifische Projekte für „Geflüchtete“) zu lösen und vermehrt auf Strategien zu setzen, die die vielfältige Stadtgesellschaft zum Maßstab für kulturelle Teilhabe erheben (Vgl. Bayer/Terkessidis 2017). (*6)Zugleich ist es mitunter vonnöten, im Sinne eines strategischen Essenzialismus*3 *(3) die Diskriminierung einzelner Gruppen zu benennen und diese gezielt zu fördern und zu empowern (vgl. Unterweger 2017).
(*6)Zugleich ist es mitunter vonnöten, im Sinne eines strategischen Essenzialismus*3 *(3) die Diskriminierung einzelner Gruppen zu benennen und diese gezielt zu fördern und zu empowern (vgl. Unterweger 2017). (*14)Für Öffnungsprozesse gibt es kein Patentrezept, (vgl. Micossé-Aikins/Sharifi 2019)
(*14)Für Öffnungsprozesse gibt es kein Patentrezept, (vgl. Micossé-Aikins/Sharifi 2019) (*15)eine grundlegende Debatte in Politik, Verwaltung und den Kulturinstitutionen über Ausschluss und Diskriminierung ist jedoch zentraler Ausgangspunkt.
(*15)eine grundlegende Debatte in Politik, Verwaltung und den Kulturinstitutionen über Ausschluss und Diskriminierung ist jedoch zentraler Ausgangspunkt.

Bruguera, Tania (2012): Manifesto on Aritsts’ Rights. Rede, gelesen beim Expert*innen-Treffen zu künstlerischer Freiheit und kulturellen Rechten, Palais des Nations, Sitz der Vereinten Nationen, Genf.

Zobl, Elke (2019): Kritische kulturelle Teilhabe: Theoretische Ansätze und aktuelle Fragen. In: Zobl, Elke/Klaus, Elisabeth/Moser, Anita/Baumgartinger, Perrson Perry (Hg.): Kultur produzieren. Künstlerische Praktiken und kritische kulturelle Produktion, Bielefeld: transcript. S. 47–60, https://doi.org/10.14361/978383944737.

Bourdieu, Pierre (2016): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (25. Auflage) Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Meyer, Tania (2016): Gegenstimmbildung. Strategien rassismuskritischer Theaterarbeit. Bielefeld: transcript.

Ahyoud, Nasiha/Aikins, Joshua Kwesi /Bartsch, Samera/Bechert, Naomi/Gyamerah, Daniel/Wagner, Lucienne (2018): Wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten in der Einwanderungsgesellschaft – eine anwendungsorientierte Einführung. Projekt: Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership, Citizens For Europe (Hg.). Berlin, https://vielfaltentscheidet.de/gleichstellungsdaten-eine-einfuehrung/ (31.12.2021).

Ernst, Zuzana/Pilić, Ivana (2021): Thinking in Practice – Kontextualisierungen der Brunnenpassage Wien. In: Pilić, Ivana/Wiederhold-Daryanavard, Anne (Hg.): Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft. Transkulturelle Handlungsstrategien der Brunnenpassage Wien. Bielefeld: transcript (2., überarbeitete und erweiterte Ausgabe), S. 11–23.

Pilić, Ivana/Wiederhold-Daryanavard, Anne (2021): Die Brunnenpassage – Einleitende Worte. In: Pilić, Ivana/Wiederhold-Daryanavard, Anne (Hg.): Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft. Transkulturelle Handlungsstrategien der Brunnenpassage Wien, Bielefeld: transcript (2., überarbeitete und erweiterte Ausgabe), S. 5–11.

Bayer, Natalie/Terkessidis, Mark (2017): Über das Reparieren hinaus. Eine antirassistische Praxeologie des Kuratierens. In: Bayer, Natalie/Kazeem-Kamiński, Belinda/Sternfeld, Nora (Hg.): Kuratieren als antirassistische Praxis, Wien: Edition Angewandte, S. 53–84.

Sharifi, Azadeh (2019): Eigene Privilegien reflektieren, Macht distribuieren. In: Zukunftsakademie NRW (Hg.): Dossier Partizipative und diskriminierungskritische Kulturpraxis: Strategische Partnerschaften und Allianzen bilden. Online: https://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Strategische-Partnerschaften.pdf (22.7.2020).

Mecheril, Paul (2016): Besehen, beschrieben, besprochen. Die blasse Uneigenheitlichkeit rassifizierter Anderer. In: Ha, Kien Nghi/Lauré al-Samarai, Nicola /Mysorekar, Sheila (Hg.): re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Münster: Unrast (2. unveränderte Auflage), S. 219–229.

El-Tayeb, Fatima (2018): European Others. In: Lafleur, Bas/Maas, Wietske/Mors, Susanne (Hg.): Courageous Citizens. How Culture contributes to Social Change. European Cultural Foundation. Amsterdam: Valiz, S. 177–187.

Yildiz, Erol (2013): Die weltoffene Stadt. Wie Migration Globalisierung zum urbanen Alltag macht. Bielefeld: transcript.

Tchakoura, David (2021): Constance – International City – Promoting sustainable and peaceful living-together in migration societies. Vortrag im Rahmen von MIS Public Open Dialogues, 23. November 2021.

Unterweger, Claudia (2016): Talking Back. Strategien Schwarzer österreichischer Geschichtsschreibung. Wien: Zaglossus.

Micossé-Aikins, Sandrine/Sharifi, Bahareh (2019): Kulturinstitutionen ohne Grenzen? Annäherung an einen diskriminierungskritischen Kulturbereich. In: Kulturelle Bildung Online: https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich (6.12.2021).

Maedler, Jens/Witt, Kirstin (2014): Gelingensbedingungen Kultureller Teilhabe. In: Kulturelle Bildung Online, https://www.kubi-online.de/artikel/gelingensbedingungen-kultureller-teilhabe (10.12.2021).

Micossé-Aikins, Sandrine/Sengezer, Eylem (2020): Warum Diversitätsentwicklung? Plädoyer für einen strukturellen Wandel im Kulturbetrieb. In: Kehr, Cordula/Sengezer, Eylem /Carolin Huth/Micossé-Aikins, Sandrine /Scheibner, Lisa/Sharifi, Bahareh: Wir hatten da ein Projekt … Diversität strukturell denken. Broschüre von Diversity Arts Culture – Berliner Projektbüro für Diversitätsentwicklung (Hg.), S. 47–50.

Liepsch, Elisa/Warner, Julian (2018): Einleitung. In: Liepsch, Elisa /Warner, Julian /Pees, Matthias (Hg.): Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen, Bielefeld: transcript, S. 9–30.

Moser, Anita (2019): Kulturarbeit in der ‚Migrationsgesellschaft‘: Ungleichheiten im Kulturbetrieb und Ansatzpunkte für eine kritische Neuausrichtung. In: Zobl, Elke/Klaus, Elisabeth/Moser, Anita /Baumgartinger, Perrson Perry (Hg.): Kultur produzieren. Künstlerische Praktiken und kritische kulturelle Produktion, Bielefeld: transcript, S. 117-134. https://doi.org/10.14361/978383944737.

Mörsch, Carmen (2017): Ansätze für eine postkoloniale Geschichtsschreibung der kulturellen Bildung in Deutschland. In: Al-Radwany, Marwa/Froelich, Caroline/Kolmans, Katharine/Paetau, Laura/Wissert, Julia/Aced, Miriam: Kulturelle Bildung im Kontext Asyl. Ein Dossier, Kulturprojekte Berlin (Hg.). Berlin. Online: https://www.kubinaut.de/media/themen/kubi_imkontextasyl.pdf (4.12.2021).

Bayer, Natalie/Kazeem-Kamiński, Belinda/Sternfeld, Nora (2017): „Wo ist hier die Contact Zone?! Eine Konversation“, in: In: Bayer, Natalie/Kazeem-Kamiński, Belinda/Sternfeld, Nora (Hg.): Kuratieren als antirassistische Praxis, Wien: Edition Angewandte, S. 23–47.

Sternfeld, Nora (2013): Playing by the Rules of the Game. Participation in the Post-representative Museum. Cumma Papers #1, Department of Art, Aalto University Helsinki. Online: https://cummastudies.files.wordpress.com/2013/08/cummapapers1_sternfeld1.pdf (28.8.2021).

Ernst, Zuzana/Hecht, Natalia/Pilić, Ivana/Wiederhold-Daryanavard, Anne (2021): Navigating Change – Strategische Partnerschaften und Impulse für die Kulturpolitik. In: Pilić, Ivana/Wiederhold-Daryanavard, Anne (Hg.): Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft. Transkulturelle Handlungsstrategien der Brunnenpassage Wien, Bielefeld: transcript (2., überarbeitete und erweiterte Ausgabe), S. 37–65.

Aikins, Joshua Kwesi/Gyamerah, Daniel (2016): Handlungsoptionen zur Diversifizierung des Berliner Kultursektors. Expertise. Projekt: Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership, Citizens For Europe (Hg.). Berlin, http://vielfaltentscheidet.de/handlungsoptionen-zur-diversifizierung-des-berliner-kultursektors/?back=101 (30.10.2021).

Baumgartinger, Persson Perry/Frketić, Vlatka (2019): Kritisches Diversity und Kulturarbeit: Wenn Aktivismus und Erfahrungswissen in den Mittelpunkt gerückt werden. In: Zobl, Elke/Klaus, Elisabeth/Moser, Anita/Baumgartinger, Perrson Perry (Hg.): Kultur produzieren. Künstlerische Praktiken und kritische kulturelle Produktion. Bielefeld: transcript. S. 47–60, https://doi.org/10.14361/978383944737.
Claudia Unterweger über den durch die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak geprägten Begriff des Strategischen Essenzialismus: „Strategisch angewendet kann Essenzialismus (strategic essentialism) dazu dienen, Strukturen sichtbar zu machen, die auf einer vermeintlichen Wesenhaftigkeit gründen. Da Essenzialismus aber ein sehr wirkmächtiges Instrument ist, ist es wichtig, dass seine Anwendung nicht unkritisch erfolgt.“ (Unterweger 2016)  (*14)
(*14)
Elisabeth Bernroitner, Ivana Pilić ( 2022): Diskriminierungskritische Kulturpolitik und ihre Praxis. Am Beispiel der Strategischen Partnerschaft des Wiener Musikvereins mit der Brunnenpassage Wien[fussnote]1[/fussnote]. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 13 , https://www.p-art-icipate.net/diskriminierungskritische-kulturpolitik-und-ihre-praxis/

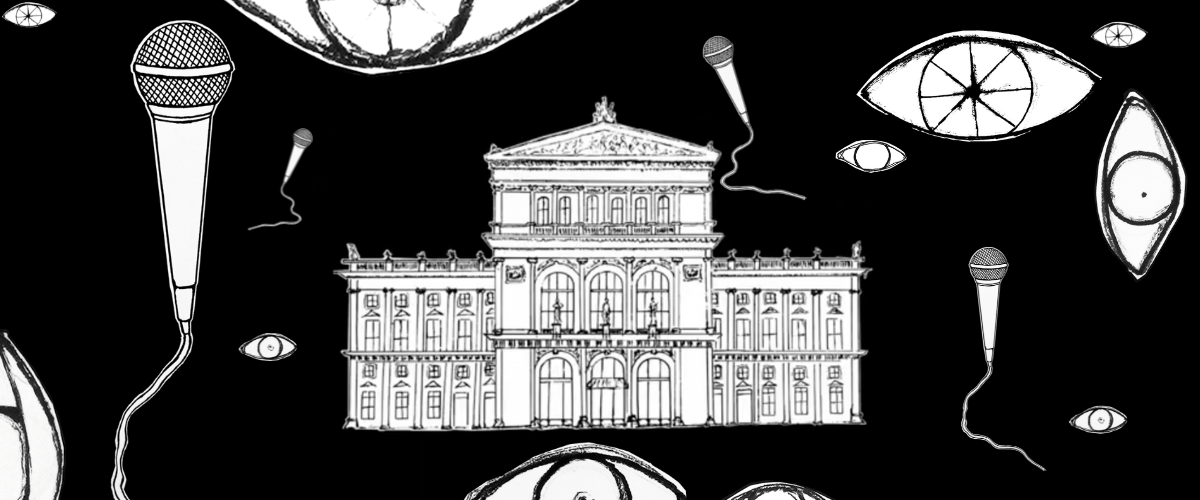
 Artikel drucken
Artikel drucken