„Diversität analysieren und gleichzeitig transformative Prozesse in Gang bringen“
Amalia Barboza, seit 2019 Professorin für künstlerische Forschung an der Kunstuniversität Linz, ist Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin. Diese Tätigkeiten sieht sie als zwei verschiedene Mittel, um dasselbe zu erreichen, wie sie im Gespräch mit Anita Moser betont. Dabei geht sie in der Kunst wie in der Wissenschaft von einem relationalen und spekulativen Ansatz aus, der den Anspruch hat, mit gesellschaftlichen Unterschieden und Konflikten „produktiv zu arbeiten und nicht zu versuchen, diese aufzuheben oder zu ignorieren“. Zentral sei – im Sinne der Kritischen Theorie – analytisch und transformativ zu denken, insbesondere auch, wenn es um das Thema Diversität geht. Im Interview spricht Amalia Barboza über Intersektionalität und die Bedeutung von Klasse und sozialer Herkunft als wichtigster Faktor zum Verständnis der Frage der Exklusion von bestimmten Gruppen aus Kunst und Kultur. Sie erzählt auch von ihrer Beschäftigung mit Migration und Heimat an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst sowie von Projekten zur Öffnung der Kunsthochschulen.
Du bist Soziologin, Künstlerin und seit 2019 Professorin für künstlerische Forschung an der Kunstuniversität Linz. Was waren auf deinem Weg dahin wichtige Stationen und Ereignisse?
Wenn du nach den wichtigen Stationen fragst, muss ich sicherlich früh anfangen. Ich komme aus einer Familie, die in der Zeit der Diktatur aus Argentinien emigrieren musste. Meine Eltern sind beide Künstler:innen und ich wuchs in einer Umgebung auf, wo die künstlerische Praxis immer mit dem Leben und auch mit politischen und gesellschaftlichen Fragen verknüpft war. Deswegen ist diese Zeit meiner Kindheit die erste wichtige Station. Nach der Schule studierte ich in Madrid Soziologie und parallel auch Kunst an einer Hochschule mit dem Schwerpunkt Bildhauerei.
Die zweite wichtige Station war Dresden. In dieser Stadt habe ich meine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben und parallel an der Hochschule für bildende Künste studiert. Ich kam nach Dresden im Jahr 1996, in einer Zeit kurz nach dem Mauerfall. Ich konnte an der Kunsthochschule erleben, wie neue Professor:innen aus dem Westen immer mehr Stellen bekamen und wie die Kunstauffassung des Ostens immer stärker in den Hintergrund geriet. Es war für mich wie eine Laborsituation, um die Konkurrenz von Ideologien in der Kunst zu erleben. In meiner Dissertation befasste ich mich mit einem wissenssoziologischen Ansatz, um solche Konkurrenzen zwischen Kunst- und Denkstilen zu analysieren. Dieser Ansatz ist für mich immer noch zentral, um das Feld der Wissenschaft und der Kunst differenzierter zu betrachten, um meine eigene Position zu reflektieren.
Die dritte Station war Frankfurt am Main. Nach der Promotion in Dresden bekam ich eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Frankfurt im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. In dieser Zeit befasste ich mich mit einer Soziologie, die transformativ zu denken ist, die Kritische Theorie. Nicht das Bestehende soll analysiert werden, sondern die Wissenschaft soll die Zustände in der Gesellschaft kritisieren und transformieren. Ich fand es damals interessant, meine eigene künstlerische Arbeit in diesen zwei Bereichen positioniert zu sehen: Einerseits die Gesellschaft zu analysieren und zu dokumentieren, aber gleichzeitig durch Installationen, durch Präsentationen im öffentlichen Raum, den Betrachter:innen die Möglichkeit zu einer kritischen Reflexion und zu einer Transformation zu geben. Das war sehr wichtig für mich, um mich zu verorten und eine Selbstverständlichkeit in meinen beiden Berufen zu bekommen. Ich bin Soziologin oder Kulturwissenschaftlerin, aber auch Künstlerin – und oft ist das nicht konträr zueinander, sondern, wenn man analytisch und auch transformativ denkt, sind es vielleicht zwei Mittel, um dasselbe zu erreichen.
Wie verstehst du in diesem Zusammenhang Transformation bzw. in welche Richtung soll diese gehen?
Die Richtung ist nicht vorgegeben, zumindest nicht von mir. Das ist es auch, was ich an der Kritischen Theorie so interessant finde: Die Kritische Theorie der ersten Generation, mit Adorno, Horkheimer oder Benjamin, vertritt eine Art Utopie-Verbot. Wir können nicht sagen, wie eine bessere Gesellschaft aussieht. Denn wenn wir zum Beispiel ein Bild von einer besseren Gesellschaft vorgeben, kann es sein, dass wir nur „bürgerliche Wünsche metaphysisch vergolden“, wie Adorno dies formulierte. Das heißt, dass wir nur aus einer bestimmten (vergoldeten) Perspektive die Vorstellung von einer besseren Gesellschaft imaginieren. Deswegen wird in der Kritischen Theorie nur kritisiert oder in Bewegung gebracht, ohne auf eine konkrete Richtung hinzuweisen. In meiner künstlerischen Arbeit ist das auch so: Ich kann nur Wege öffnen oder aufzeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Welt zu gestalten. Inwieweit dieses Angebot angenommen wird, um frei weiter zu denken, ist jeder:jedem selbst überlassen.
„Dieser relationale und spekulative Ansatz hat den Anspruch, mit Konflikten und Unterschieden, die es in einer Gesellschaft gibt, produktiv zu arbeiten und nicht zu versuchen, diese aufzuheben oder zu ignorieren.“
Du beschäftigst dich in deiner theoretischen wie praktischen Arbeit als Wissenschaftlerin und Künstlerin mit Fragen zu Migration und Transkulturalität. Welche Rolle spielt in diesen Kontexten Diversität?
Es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich mich in den letzten Jahren immer mehr mit Migration auseinandergesetzt habe, und zwar seit der Zeit, als in Dresden 2015 die sogenannten Pegida-Demonstrationen anfingen. Ich war damals schockiert. Ich hatte mich in Dresden sehr wohl gefühlt und die Menschen dort in ihrer Frustration nach der Wende auch sehr gut verstanden. Aber dass sich der Frust in diese Richtung bewegte, hat mich schon sehr beschäftigt. Ich war fassungslos – und manchmal verärgert, weil ich nicht in Dresden sein konnte. Ich lebte damals in Frankfurt und dachte, wenn ich in Dresden wäre, könnte ich etwas tun. Deswegen habe ich in dieser Situation begonnen, Projekte zu machen, durch die sichtbar wird, welchen Mehrwert die Migration für die Gesellschaft bringt.
In der Zeit wohnte ich noch in Frankfurt, aber ich hatte schon an die Universität des Saarlandes gewechselt, wo ich seit 2013 als Junior-Professorin für Kulturwissenschaften unterrichtete. Mit den Studierenden befassten wir uns mit Orten in der Stadt, die von Migrant:innen gestaltet wurden. Wir besprachen auch verschiedene Ansätze, die in der Zeit zur Diskussion standen: Transkulturalität, Interkulturalität, Heimat in der Ferne, Diversität, bewegte Heimat, Transtopien waren einige der Themen. Nicht nur diese Konzepte, sondern auch methodologischen Fragen beschäftigten mich damals. Konkret die Frage, wie kann die Kunst neue Methoden entwickeln, um diese Diversität der Migration zu analysieren?
In dieser Zeit habe ich auch ein Kunstprojekt zu dem Thema durchgeführt: Brasilien am Main. Es war gekoppelt an ein Reisestipendium der hessischen Kulturstiftung für Künstler und Künstlerinnen, um eine einjährige Auslandsreise zu machen. Ich wollte schon seit Langem nach Brasilien, wo ich früher eine Zeitlang gelebt hatte. Ich wusste aber, dass ich eigentlich gar nicht nach Brasilien kann, weil ich an der Universität arbeite und Familie habe. Daher hatte ich die Idee, einen Antrag zu stellen, um ein ganzes Jahr in Brasilien zu verbringen, ohne Frankfurt zu verlassen, da in Frankfurt sehr viele Brasilianer:innen leben. Mit dem Antrag hat es wider Erwarten tatsächlich geklappt. Ich bekam das Stipendium und verbrachte ein Jahr mit dem Brasilien in Frankfurt.
Damals gab es in Brasilien sehr viele politische Bewegungen, Abspaltungen in der Gesellschaft und Demonstrationen. Auch in Frankfurt fanden von Brasilianer:innen organisierte Demonstrationen statt. Die Spaltung zwischen linken und rechten Gruppen war so groß, dass diese Demonstrationen bald aufhörten. In dieser Zeit war deutlich zu sehen, dass Brasilien ein Konstrukt ist, getragen von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen politischen Gesinnungen. Ich wollte in meinem Projekt diese Diversität abbilden, aber auch einen Möglichkeitsraum öffnen. Am Ende unternahm ich doch noch eine vierwöchige Reise nach Brasilien, mit der Intention, Verknüpfungen innerhalb dieser Diversität herzustellen. Diese Methode nannte ich einen relationalen und transkulturellen Ansatz, weil durch Relationen transkulturelle Prozesse sichtbar werden. Aber es war auch ein spekulativer Ansatz, weil Fiktion eine Rolle spielt, indem zukünftige Möglichkeiten für Partizipation eröffnet werden, jedoch ohne konkrete Realisierung. Dieser relationale und spekulative Ansatz hat den Anspruch, mit Konflikten und Unterschieden, die es in einer Gesellschaft gibt, produktiv zu arbeiten und nicht zu versuchen, diese aufzuheben oder zu ignorieren.
Mein Ansatz zu Migration und Diversität ist, dass die Diversität dynamisch verstanden werden soll. ‚Migrant:innen‘ klingt erstmal recht eindeutig, aber wenn die Migrationsgruppen konkret analysiert werden, wird die Diversität sichtbar. Diese Diversität zu zeigen, war mir wichtig in meinem Brasilienprojekt. Gleichzeitig ist das Transformative wichtig. Soll Diversität ‚nur‘ analysiert werden – diese Diversität, die immer komplexer wird, je genauer man hinschaut? Hierfür benutzen die Sozialwissenschaftler:innen heute den Begriff der Intersektionalität, um zu betonen, dass es nicht nur nationale Unterschiede oder lokale bzw. regionale Unterschiede gibt, sondern auch eine Mischung aus Klassen-, Gender-, oder Generationsunterschiede. Je nachdem, aus welcher Perspektive geschaut wird, sind die Unterschiede anders hervorzuheben. Dieser Begriff der Intersektionalität ist jetzt Mode, aber das Phänomen ist in der Soziologie schon seit Langem bekannt. Zum Beispiel hat Pierre Bourdieu, um Klassenunterschiede differenzierter zu analysieren, verschiedene Arten von Kapital unterschieden: kulturelles, symbolisches, soziales, ökonomisches Kapital. Oder Karl Mannheim sprach im Zusammenhang mit der Aufgabe der soziologischen Zurechnung von mehreren Zuschreibungsmerkmalen, die nicht nur dynamisch zu verstehen sind, sondern auch sich durchkreuzen oder verklammert sind. Heute wird von Intersektionalität und von Mehrfachzugehörigkeit gesprochen.
Für mich ist nicht nur wichtig, die Diversität in dieser Intersektionalität und Dynamik zu analysieren, sondern gleichzeitig auch transformative Prozesse in Gang zu bringen, damit die Menschen sehen, dass trotz aller Unterschiede alles im Wandeln zu betrachten ist, es Gemeinsamkeiten oder Kooperationsmöglichkeiten gibt und dass sich vieles vielleicht noch verhandeln lässt. Mich interessiert auch die Idee von der Radikalen Demokratie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Sie sprechen von einer Artikulation, wo Intersektionalität mitgedacht wird, aber nicht statisch zuschreibend, sondern dynamisch, transformativ.
„Wenn wir einen Heimatbegriff haben, der dynamisch ist, aber gleichzeitig den Konflikt zulässt und dieses ‚Immer-in-Verhandlung-Sein‘ eröffnet, dann lässt es sich mit diesem Begriff ganz anders arbeiten als mit dem Heimat-Begriff von rechten Parteien, der sehr statisch ist.“
Laclau und Mouffe zufolge sind auch Dissens und Konflikt als unerlässliche Basis einer Demokratie zentral.
Der Konflikt bleibt, er ist die ganze Zeit da, aber es gibt auch immer wieder Verhandlungen zwischen den Personen, die an einem Konflikt teilhaben. Verhandlung ist auch ein Begriff, den ich benutze, um diese Transformationsmöglichkeiten zu betonen. Ich habe ein Buch mit Kolleg:innen der Universität des Saarlandes herausgegeben, in dem wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben: Was ist Heimat? Wenn wir einen Heimatbegriff haben, der dynamisch ist, aber gleichzeitig den Konflikt zulässt und dieses „Immer-in-Verhandlung-Sein“ eröffnet, dann lässt sich damit ganz anders arbeiten als mit dem Heimatbegriff von rechten Parteien, der sehr statisch ist. Auch kann der Heimatbegriff nicht nur in die Vergangenheit gerichtet sein, sondern ebenso in die Zukunft – im Sinne der Kritischen Theorie verstanden als eine utopische Projektion nach vorne, die offen für weitere Verhandlungen bleibt. Interessant ist, dass schon in der Zeit des Nationalsozialismus linke Theoretiker wie Ernst Bloch gefordert haben, den Heimatbegriff nicht den Rechten zu überlassen.
Du hast Intersektionalität angesprochen. Wie siehst du Klasse und soziale Herkunft im Kontext von Diversität in Kunst und Kultur?
Das ist für mich immer noch das Wichtigste, um die Frage der Exklusion von bestimmten Gruppen zu verstehen. Es ist immer noch so, dass die Klassenunterschiede, das ökonomische Kapital, eine sehr wichtige Rolle spielen. Sichtbar ist das unter anderem an den Universitäten. Es gibt zwar eine Öffnung, aber tatsächlich ist es so, dass viele Kinder, mit Migrationshintergrund oder aus der ‚unteren‘ Klasse, nicht in die Universität kommen, weil sie kein Gymnasium besucht und keine Matura haben. Nur an Kunsthochschulen kann man sich ohne Matura bewerben. Seit ich in Linz an der Kunstuniversität bin, mache ich eine Arbeit über Biografien von Studierenden, die ohne Matura an der Kunsthochschule studiert haben. Ich glaube, da gibt es Expertisen oder Lebenswege, die man bekanntmachen kann, um zu zeigen, wie es möglich ist, dass Kinder ohne Matura eine universitäre Ausbildung bekommen.
Ich beschäftige mich – u.a. ausgehend vom eigenen biografisch bedingten Interesse – auch mit dem Thema und bot vorletztes Semester eine Lehrveranstaltung zu Klassismus im Kulturbetrieb an. Es waren mehrheitlich Studierende dabei, die selbst aus sozio-ökonomisch benachteiligten Verhältnissen oder Arbeiter:innenfamilien kommen. Wir hatten sehr lebendige Diskussionen und ich fand bemerkenswert, dass das Thema so eine Leidenschaft bei den Studierenden entfachte …
… weil es an den Universitäten und Hochschulen eben keinen oder kaum Platz gibt, um darüber zu reden. Im Prinzip müssen die Studierenden, die so einen Lebensweg haben, in den ersten Jahren an der Hochschule zum Beispiel lernen, anders zu reden, sich anderes zu bewegen. Die Sprache ist sehr wichtig, ebenso die Umgangsformen.
Wie sieht deine Arbeit mit den Studierenden in dem Projekt über Lebenswege konkret aus?
Ich bin bei dem Projekt noch am Anfang. Es hat auch einen biografischen Hintergrund: In Frankfurt waren meine Kinder in einer Grundschule in einem Stadtteil, wo viele Migrant:innen leben. Bei den Kindern mit Migrationshintergrund gab es viele mit großen Talenten, aber dadurch, dass die Eltern diese nicht unterstützten, schaffte es niemand von ihnen, auf das Gymnasium zu gehen. So sind sie von der Grundschule in die Hauptschule gegangen. Bei den damaligen Freunden von meinen Kindern habe ich gemerkt, dass genau diese Schüler:innen, die nicht ins Gymnasium kamen, sehr kreativ waren, mit dem Körper, durch ihre Performanz, mit der Sprache, durch Witze und andere Dinge. Viele hatten Begabungen, die für die Kunst sehr wichtig sind.
Ein weiteres Projekt von mir an der Kunstuniversität Linz ist, mit Mittelschulen zu kooperieren, um dort Workshops mit den Kindern zu machen, damit sie sehen, dass an der Kunsthochschule zu studieren nicht bedeutet, dass sie malen können oder perspektivische Darstellung beherrschen müssen, sondern dass es auch kreative Praktiken in ihrem Alltag gibt, die für ein Kunststudium sehr wichtig sein können. Ziel des Projektes ist es, diese Praktiken zu erheben und gleichzeitig das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir diese Praktiken an den Kunsthochschulen brauchen und dass sie sich bei uns bewerben sollen, weil sie keine Matura brauchen. Wir laden Künstler:innen ein, diese Workshops zu machen, dabei kooperieren wir mit dem Atelierhaus Salzamt in Linz.
„Wenn tatsächlich Diversität im Kulturbereich gefördert werden soll, dann darf es nicht so viele Hürden geben in der Bürokratie.“
Wo siehst du in Österreich in Bezug auf Diversität in Kunst und Kultur den dringlichsten Veränderungsbedarf?
Ich habe den Eindruck, dass es hier im Unterschied zu Deutschland mehr Förderungsmöglichkeiten im Bereich der Kultur gibt, weniger jedoch im Bereich der Wissenschaft, zum Beispiel für Doktorand:innen. Aber ich habe gehört, dass es auch im Kulturbereich viel schwieriger geworden ist, Anträge zu stellen, weil es viel bürokratischer geworden ist. Wenn tatsächlich Diversität im Kulturbereich gefördert werden soll, dann darf es nicht so viele Hürden geben in der Bürokratie. Anträge zu stellen, müsste viel einfacher sein, um Kunst und Kultur für viele Menschen zu öffnen, die tatsächlich sehr kreativ sind, aber für die Bürokratie keine Zeit oder zu wenig Expertise haben.
Du hast dich mit Räumen des Ankommens in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Wo siehst du Hürden, die das Ankommen erschweren oder gar unmöglich machen?
Vielleicht gleich vorweg: genau dasselbe. Diese ganze Bürokratisierung ist ein großes Problem. Die Menschen müssen oft jahrelang warten, auf Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Wohnrecht … Das ist unglaublich. Menschen, die so viel anzubieten haben. Und wenn sie dann endlich eine Arbeitserlaubnis haben, bauen sie etwas auf und haben immer noch so viel Arbeit mit den ganzen Anträgen und der Verwaltung. Ich habe Geschichten über Migrantinnen und Migranten gesammelt, die sich in Saarbrücken selbständig gemacht und an einem Ort ihre Existenz aufgebaut haben: ein Restaurant, einen Lebensmittelladen, eine Tanzschule. In diesen Geschichten kam immer wieder die Bürokratie zur Sprache. Zum Beispiel sagte ein Italiener, der ein Restaurant hat: „Die Energie zum Kochen habe ich, auch die Energie mit den Kunden zu sprechen – das ist das, was ich am meisten liebe. Aber das Schlimmste ist diese Bürokratie. Hier verliere ich meine Energie.“
Wir arbeiten in Salzburg gerade daran, gemeinsam mit D/Arts einen breiten Austausch über Diversität in Kunst und Kultur zu initiieren und ein Netzwerk aufzubauen. Wie siehst du eine Initiative wie D/Arts, und was kann sie im besten Fall erreichen?
Ich finde es sehr wichtig, wenn Personen ein Problem in der Gesellschaft erkennen und aus eigener Initiative eine entsprechende Dienstleistung anbieten. Denn solche Initiativen haben eine ganz andere Expertise und ein anderes Bewusstsein als öffentliche Institutionen mit ihren Angeboten.
Im Rahmen der Präsentation eines Doktoranden, Michael Wittmann, der bei mir an der Kunstuniversität promoviert, haben wir uns vor Kurzem mit der Frage beschäftigt, wie solche Initiativen entstehen, aus welchen Erfahrungen heraus und mit welchen Hintergründen. Wer sind die Personen, die das machen? Woher holen sie sich Expertisen? Kommen diese Expertisen aus dem eigenen Erfahrungsraum? Oder werden die Initiativen von Personen entwickelt, die diese Erfahrungen nicht haben, aber erkannt haben, dass sie helfen müssen? In der Wissenssoziologie gibt es zwei interessante Begriffe: die freischwebende Intelligenz, die außerhalb von den Erfahrungsräumen ist und die Distanz braucht, und die organische Intelligenz, die eng mit bestimmten Erfahrungsräumen verbunden ist. Ich finde interessant, diese zwei Möglichkeiten zu reflektieren. Wie ist die Initiative D/Arts entstanden? Ist es eine freischwebende Initiative oder eine organische, die aus der Erfahrung entstanden ist?
„Enge und eindimensionale Zuschreibungen sind problematisch, weil wir immer Erfahrungsräume ausklammern. Und es stellt sich auch die Frage, ob nicht manchmal eine Distanz zu diesen Erfahrungsräumen produktiv sein kann, um ein besseres Verständnis zu erreichen.“
D/Arts sehe ich als organische, aus der Erfahrung entstandene Initiative. Im Kuratorinnen-Team und Netzwerk sind großteils Personen, die selbst sehr unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf Diversität und Diskriminierungen mitbringen. Das bringt mich zur nächsten Frage: Wie siehst du Identitätspolitiken und „cancel culture“ – sowohl konkrete Ereignisse als auch den Diskurs darüber? Das Thema wurde zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage, wer das von der Schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman anlässlich von Joe Bidens Inauguration vorgetragene Gedicht übersetzen soll, diskutiert.
Ich konnte bei dem konkreten Fall die Bedenken verstehen. Gleichzeitig ist es gefährlich, bestimmen zu wollen, welche Person für eine Übersetzung geeignet ist. Es wird so einfach gesagt, „nur eine Person mit afro-amerikanischem Hintergrund kann diesen Text übersetzen“. Aber was ist, wenn andere Erfahrungsräume für die Übersetzung wichtig sind, zum Beispiel Exklusionserfahrung auf Grund von Klassenrassismus? Diese engen und eindimensionalen Zuschreibungen sind problematisch, weil wir immer Erfahrungsräume ausklammern. Und es stellt sich auch die Frage, ob nicht manchmal eine Distanz zu diesen Erfahrungsräumen produktiv sein kann, um ein besseres Verständnis zu erreichen. Die Figur des ‚Fremden‘ hatte in der Soziologie diese Funktion: Sie war zum Beispiel für den Soziologen Georg Simmel eine Figur, die zu keiner Gruppe gehört und durch diese Distanz besser in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen.
Noch eine abschließende Frage: Wie nimmst du den Kulturstandort Salzburg wahr in Bezug auf Diversität?
Ich bin leider erst seit Kurzem in Österreich und kenne die Kulturszene in Salzburg nicht gut. Spontan kann ich jetzt nur eine frühere Erinnerung wachrufen. Ich war vor einigen Jahren auf der Durchreise in Salzburg und auf einem Platz stand eine ‚Jedermann-Bühne‘, eine Bühne, die offen war für alle, die mitsingen oder mitspielen wollten. Das hat mir sehr gut gefallen. Mein damals 9-jähriger Sohn hat auf dieser Bühne die „Seeräuber-Jenny“ von Bertolt Brecht gesungen. Dieses Lied mit „Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden…“ ist ein Lied, das ich liebe und welches er schon als Kind von mir lernte. Diese Bühne ist mir in Erinnerung geblieben: eines von vielen Beispielen, wie ein Kulturstandort wie Salzburg, der sehr für einen gehobenen Tourismus bekannt ist, eine Plattform für viele Stimmen in der Stadt öffnen kann.
Weiterführende Literatur:
Barboza, Amalia (2009a): Die ‚jüdische Identität’ der Frankfurter Schule. In: Boll, Monika/Gross, Raphael (Hg.): Die Frankfurter Schule in Frankfurt. Eine Rückkehr nach Deutschland. Jüdisches Museum Frankfurt. Göttingen: Wallstein, S. 162-169.
Barboza, Amalia (2009b): Karl Mannheim. Konstanz: UVK.
Barboza, Amalia (2010): Zwei Frankfurter Schulen. Wissenssoziologie versus Kritische Theorie? In: Herrschaft, Felicia/Lichtblau, Klaus (Hg.): Soziologie in Frankfurt. Wiesbaden: VS Verlag, S. 161-203.
Barboza, Amalia (2019a): Brasilien am Main. Bielefeld: transcript.
Barboza, Amalia et al. (2016) (Hg): Räume des Ankommens. Topographische Perspektiven auf Migration und Flucht. Bielefeld: transcript.
Barboza, Amalia/Krug-Richter, Ruby (2019b) (Hg.): Heimat verhandeln. München/Wien: Böhlau.
Fotos aus:
Barboza, Amalia (2019a): Brasilien am Main. Bielefeld: transcript.
topographienderdiversitaet.wordpress.com
Amalia Barboza, Anita Moser ( 2022): „Diversität analysieren und gleichzeitig transformative Prozesse in Gang bringen“. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 13 , https://www.p-art-icipate.net/diversitaet-nicht-nur-analysieren/





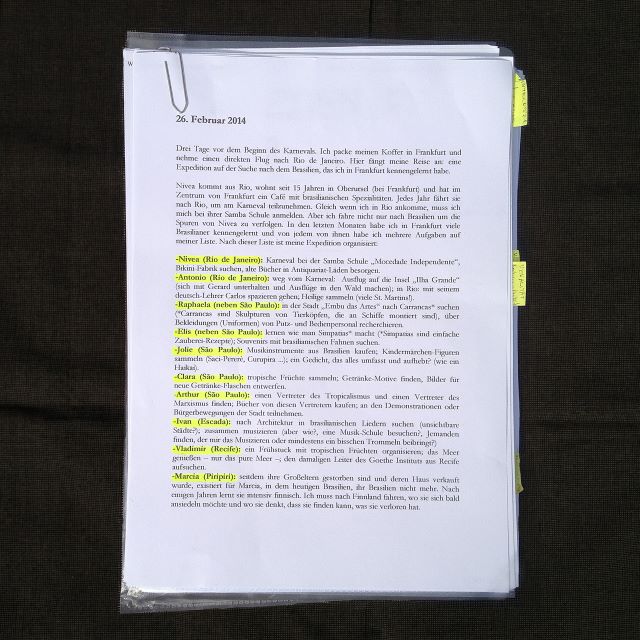

 Artikel drucken
Artikel drucken Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis