Die ganze Welt in Zürich – Konkrete Interventionen in die Schweizer Migrationspolitik
Das Projekt „Die ganze Welt in Zürich“ (2015/2016),*5 *(5) welches ich gemeinsam mit Katharina Morawek über den Zeitraum von eineinhalb Jahren in der Shedhalle Zürich entwickelt und umgesetzt habe, setzte sich zum Ziel das dialogische ästhetische Potential von Kunst mit politischer Praxis zusammenzuführen. Der Fokus des Projekts lag auf der Schweizer Migrationspolitik und der Frage nach einer Entwicklung und Implementierung einer Urban Citizenship (StadtbürgerInnenschaft) in Zürich.
Öffentliche Debatten zum Thema Migration und Flucht handeln vor allem von den Zwängen einer vermeintlichen Realpolitik, sie lassen dabei eine grundsätzliche und politische Auseinandersetzung jenseits des mutmaßlich Machbaren vermissen. Wie würden etwa die Zugänge zu städtischen Ressourcen für MigrantInnen und Flüchtlinge in einer Stadt wie Zürich aussehen, wenn diese ihnen als StadtbürgerInnen alle entsprechenden sozialen Rechte zugestehen würde? Wo gibt es politische und gesetzliche Spielräume, um das Recht auf Rechte für alle in einer Stadt lebenden Menschen einzufordern? Wie kann hierfür gesellschaftlicher und politischer Druck aufgebaut werden?
Das Projekt und die Ausstellungsarchitektur orientierten sich an der Metapher des Hafens, die Mobilität, Globalität, Handeln und Aushandeln, Ankunft, vor Anker gehen, Vielfalt und Weltoffenheit evoziert. Das Projekt setzte sich aus den dialogischen Formaten „Hafengespräch“, „Hafenforum“ sowie Arbeitstreffen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zusammen. Die Ausstellung bildete den architektonischen Raum für diese Formate. Für die Arbeitsgruppe, welche sich ab Sommer 2015 regelmäßig in der Shedhalle Zürich traf und die strategische und inhaltliche Ausrichtung des Projekts bestimmte, konnten folgende AkteurInnen gewonnen werden: Bah Sadou (Aktivist, „Autonome Schule Zürich“), Bea Schwager (Leiterin SPAZ, Anlaufstelle für Sans Papiers in Zürich), Kijan Malte Espahangizi (Geschäftsführer, Zentrum „Geschichte des Wissens“, ETH / Universität Zürich) Osman Osmani (Gewerkschaftssekretär für Migration, UNIA), Rohit Jain (Sozialanthropologe, Universität Zürich / Zürcher Hochschule der Künste), Tarek Naguib (Jurist, Zentrum für Sozialrecht / Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW).
Die „Hafengespräche“ wurden von den Mitgliedern dieser Gruppe konzipiert. Es wurden VertreterInnen von Interessensgruppen, EntscheidungsträgerInnen, StadtpolitikerInnen, MitarbeiterInnen öffentlicher Einrichtungen und AktivistInnen eingeladen. Die Hafengespräche fanden in der Shedhalle dezidiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit im eigens dafür gebauten „Hafenturm“ statt. Zudem wurden Bootsfahrten organisiert, bei welchen die TeilnehmerInnen am Bürkliplatz mit einem Boot abgeholt und zur Shedhalle, die unweit des Stegs vom Hafen Wollishofen liegt, gebracht wurden. Die TeilnehmerInnen wurden durch Performances/Gesprächssituationen an Bord spezifisch auf das jeweilige Hafengespräch eingestimmt.

„Die ganze Welt in Zürich“ Eröffnungsschifffahrt zur Ausstellung in der Shedhalle am 22. Oktober 2015, Foto: Martin Krenn
Das zweite Format, das „Hafenforum“ war öffentlich und fand dreimal zu den Themen „Urban Citizenhip“, „Social Practice“ und „Doing City“ statt. Dabei trafen lokale und internationale AkteurInnen aufeinander. Die Inhalte und Strategien, welche in den Hafengesprächen und in der Arbeitsgruppe erarbeitet wurden, standen hier erneut zur Diskussion.
Martin Krenn ( 2016): Das Politische in sozialer Kunst. Intervenieren in soziale Verhältnisse. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 07 , https://www.p-art-icipate.net/das-politische-in-sozialer-kunst/

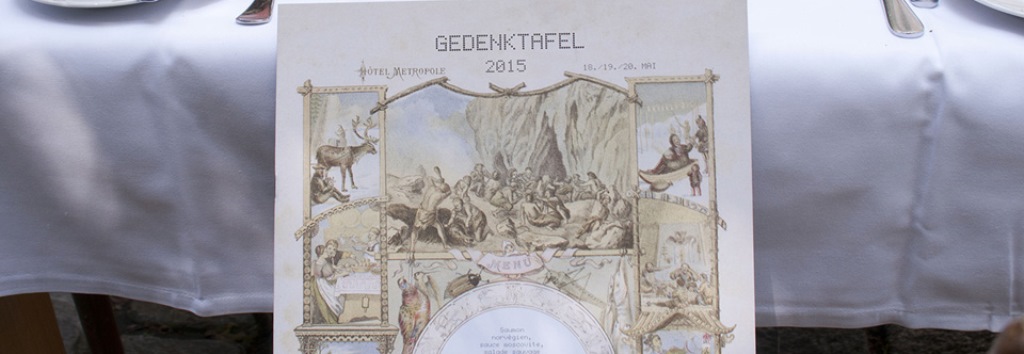

 Artikel drucken
Artikel drucken