Über Körper, kulturelle Normierung und die Anforderung einer „Kultur für alle“ im Kontext von Dis_ability
Behinderung im Kontext eines normierenden Gesellschafssystems – Ableismus
Ableismus bezeichnet jene Form der Diskriminierung, von der Personen mit Behinderung* aufgrund dieser Zuschreibung betroffen sind. Der Begriff wird vom englischen „to be able“ (Deutsch: „fähig sein“) abgeleitet. Dieser Begriff meint, dass unser menschlicher Körper sowie unser Denken, Fühlen und Handeln auf eine vom gesellschaftlichen System vorgegebene Weise funktionieren müssen, und falls sie dies nicht tun, zumindest kontrollierbar sein müssen. Diese Vorstellungen vom Fähig-Sein tragen jene Gewalt in sich, die als Ableismus bezeichnet wird. Nicht-Behinderung*, also angebliche Fähigkeit, wird dabei als Standard vorausgesetzt. Das „Funktionieren“ wird in einer Art Ideologie einer physischen, psychischen oder mentalen Behinderung* gegenüber gestellt und als „etwas Besseres“ gewertet (vgl. Hutson 2010: 61 f.). (*4)
(*4)
Die Normalität der Nicht-Behinderung wird also sowohl von behinderten* als auch nicht-behinderten* Menschen erfüllt und getragen. Ableismus ist deshalb grundlegend auch die Verantwortung von nicht-behinderten* Menschen (s.a. Mayer 2013: 26). (*10)
(*10)
Privilegien in unserem ableistischen Gesellschaftssystem
„Kultur für alle und mit allen“ bedeutet, dass alle Menschen in allen Bereichen uneingeschränkten Zugang zu Kunst, Kultur und Medien haben. Dabei dürfen weder bestehende Privilegien, also Vorteile, reproduziert, noch unüberwindbare neue geschaffen werden (vgl. Hoffmann 1981: 29). (*5) Denn es ist wichtig, sich der eigenen Vorteile eines für andere diskriminierenden Gesellschaftssystems bewusst zu sein bzw. zu werden und aus dieser Perspektive heraus anderen den Alltag zu erleichtern (vgl. Hoffmann 1981: 271; 295; s.a. S. 297 f.;
(*5) Denn es ist wichtig, sich der eigenen Vorteile eines für andere diskriminierenden Gesellschaftssystems bewusst zu sein bzw. zu werden und aus dieser Perspektive heraus anderen den Alltag zu erleichtern (vgl. Hoffmann 1981: 271; 295; s.a. S. 297 f.; (*5) s.a. Zimmerman 2013: o.S.).
(*5) s.a. Zimmerman 2013: o.S.). (*23)
(*23)
Mit dem Blick auf Normierungszwänge sowie Macht- und Gewaltverhältnisse liegt es nahe, sich auch mit den Vorteilen – also Privilegien – zu beschäftigen: 1. mit jenen Privilegien, die nicht-behinderten* Menschen in einem ableistisch-normierenden Gesellschaftssystem zukommen, und 2. mit jenen Vorteilen, die Menschen mit Behinderung* neben ihren Benachteiligungen auch haben.
Privilegien von Nicht-Behinderung* sind z. B. selbstverständlich als normal und zugehörig betrachtet zu werden, ohne die eigene (körperliche) Verfassung erklären, begründen oder rechtfertigen zu müssen. Sie gilt als unhinterfragte Normalität (vgl. Röggla 2013: 9; (*16) Bee 2013: 28-30).
(*16) Bee 2013: 28-30). (*1) Daraus ergeben sich auch spezielle Vorteile, Vorrechte oder Sonderrechte. Es sind sogenannte „Selbstverständlichkeiten“ wie:
(*1) Daraus ergeben sich auch spezielle Vorteile, Vorrechte oder Sonderrechte. Es sind sogenannte „Selbstverständlichkeiten“ wie:
- generell als erwachsene, ernst zu nehmende Person angesprochen und wahrgenommen zu werden,
- selbstverständlich barrierefreie Zugänge,
- eine Welt, die so ausgerichtet ist, dass Dinge zumeist alleine und ohne fremde Hilfe ausgeführt werden können,
- in ein allgemeines Zeitsystem/einen allgemeinen Zeitrhythmus mit den körperlichen, psychischen oder mentalen Gegebenheiten hineinzupassen (s.a. Peggy MacIntosh in Röggla: 9).
 (*16)
(*16)
Elisabeth Magdlener ( 2018): Über Körper, kulturelle Normierung und die Anforderung einer „Kultur für alle“ im Kontext von Dis_ability. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 09 , https://www.p-art-icipate.net/ueber-koerper-kulturelle-normierung-und-die-anforderung-einer-kultur-fuer-alle-im-kontext-von-dis_ability/

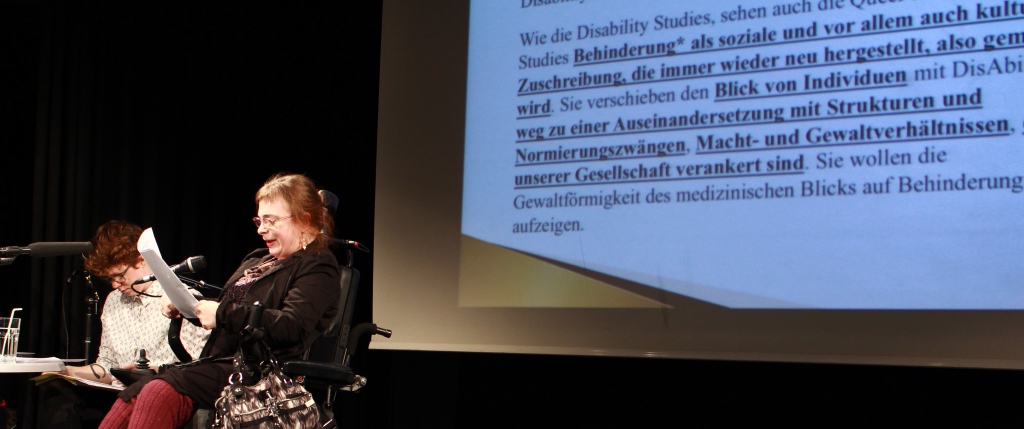

 Artikel drucken
Artikel drucken