1. Einleitung
Etwa bis zu meinem 15. Lebensjahr verbrachte ich etliche Wochenenden im Fußballstadion. Trotz Menschenmassen und meiner damals bereits immer wieder aufflackernden Soziophobie fühlte es sich an, als könne mir dort nie etwas passieren; als beständen alle meine Sorgen für eine Weile nur darin, ob der Schiri fair pfeifen würde. – Und alle waren auf meiner Seite.
Im Kontrast dazu verbrachte ich einen Teil meiner Sommerferien als Schülerin mehrmals auf Seminaren für klassische Konzertgitarrist:innen und Mandolinist:innen; letztere hoben den Altersdurchschnitt der Teilnehmer:innen deutlich an. Mein Gitarrenprofessor sagte über sie, halb im Scherz und halb ernst: „Technisch hervorragend sind sie nicht, aber es ist mir tausendmal lieber, wenn sich die alten Leute in der Pension mit so etwas beschäftigen, als wenn sie Bier trinken und Fußball schauen.“
Ich lachte. Aber gleichzeitig machte sich ein neuer Gedanke in meinem Bewusstsein breit: „Ich muss mich schämen, was ich mache, ist nicht gut.“
Das Interesse für Fußball wich irgendwann meinem Interesse für Kunst; und als Jahre später mein Wunsch in Erfüllung ging und ich meinen eigenen Atelierplatz an der Kunstuniversität Linz bezog, glaubte ich zu wissen, wo ich nun hingehörte: zu den Kunstschaffenden – in den erlesenen Klub der Individuellen, der kritischen Kunst- und Kulturrezipient:innen und -produzent:innen.
Das Gefühl hielt einen halben Tag lang an. Scheinbar niemand dort, außer mir, benutzte das Wort „Oida“, als wäre es ein Satzzeichen, niemand sonst vermisste es, mit seiner Familie abends RTL zu schauen und alle kannten Namen, vermutlich von Künstler:innen, die ich noch nie vorher gehört hatte: Baselitz, Hockney, Lassnig – während die anderen angeregt diskutierten, las ich am Smartphone nach, wer denn wer sei.
Maßnahmen, um zeitgenössische Kunst für Menschen außerhalb dieser Szene verträglicher zu machen, wurden strikt abgelehnt, belächelt, abgewertet, und ich versuchte mich anzupassen und auch so über Kunst zu sprechen, wie es „richtig“ war.
Nachdem ich unter meinen Studienkolleg:innen schließlich doch eine Hand voll Menschen gefunden hatte, bei denen ich das Gefühl hatte, so sein zu können, wie ich bin, wurden meine Wochenenden mit Theaterbesuchen gefüllt.
Im Theater fühlte es sich, wie einige Jahre zuvor im Fußballstadium, für die Dauer einer Vorstellung wieder so an, als könne mir nichts passieren; alle meine Probleme bestanden in Fragen, wie etwa, ob das Bühnenbild interessant sei oder ob der Text meiner Lieblingsschauspielerin mich mitzureißen vermochte.
Das Stück Stadium von Mohamed El Khatib, das ich mir zuerst skeptisch und ab der zweiten Halbzeit begeistert angesehen hatte, lieferte mir dann eine Erklärung dafür, warum mich der Kampf der Kultur- und Bildungsklassen im Inneren ständig so bewegt, warum mich die abgeneigte Haltung gegenüber zugänglicher zeitgenössischer Kunst so beschäftigt und warum ich mich nicht mehr schämen will:
Wir wollen von etwas mitgerissen werden, kurz unser Leben vergessen; ein Gefühl von wir wollen mehr, von Noradrenalin und Spannung. – Wir sind alle nur sensation seekers mit unterschiedlichen sensations.
Maria Schwarzmayr ( 2020): Die Kunst liebt die Proleten … sie kann es ihnen nur nicht zeigen. In: p/art/icipate – Kultur aktiv gestalten # 11 , https://www.p-art-icipate.net/die-kunst-liebt-die-proleten-sie-kann-es-ihnen-nur-nicht-zeigen/

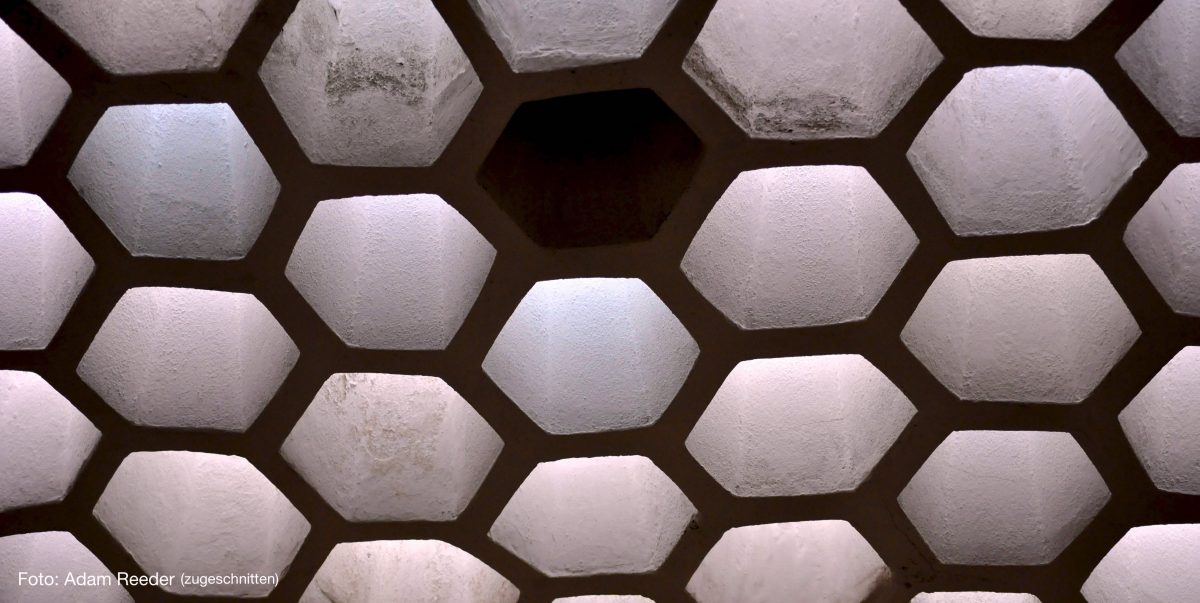

 Artikel drucken
Artikel drucken